Blasenkrebs: Symptome, Stadien, Lebenserwartung, Therapie und Neuigkeiten

Blasenkrebs (Blasenkarzinom, Harnblasenkrebs)
Blasenkrebs ist eine häufige Krebserkrankung vorwiegend älterer Menschen, die deutlich mehr Männer als Frauen betrifft. Da es anfangs meist keine typischen Symptome verursacht, wird das Harnblasenkarzinom oft erst in einem höheren Krankheitsstadium entdeckt. Blasenkrebs geht in der Regel von der Blasenschleimhaut aus und für seine Entstehung werden verschiedene Risikofaktoren verantwortlich gemacht.
Themen im Überblick:
➤ Blasenkrebs – das Wichtigste in Kürze12
➤ Entstehung & Risikofaktoren
➤ Blasenkrebs erkennen
➤ Krankheitsverlauf
➤ Behandlung und Nachsorge von Blasenkrebs
➤ Leben mit Harnblasenkrebs
➤ Blasenkrebs: Fortschritte in der Therapie
➤ Häufig gestellte Fragen
Blasenkrebs – das Wichtigste in Kürze
Blasenkrebs gehört zu den häufigeren Krebsarten. In Deutschland erkranken pro Jahr insgesamt über 30.000 Menschen neu an Blasenkrebs. Männer sind dreimal so häufig betroffen wie Frauen. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 75 Jahren (Männer) bzw. 76 Jahren (Frauen).
Häufig wird das Harnblasenkarzinom erst spät diagnostiziert. Es existieren keine gesetzlichen Früherkennungsprogramme für Blasenkrebs.
Die Diagnose des Harnblasenkarzinoms erfolgt bei Frauen häufiger erst in einem höheren Tumorstadium. Dies schlägt sich in einer schlechteren Prognose für Frauen nieder. Für eine frühe Diagnose, die die Voraussetzung für eine frühzeitige Behandlung des Blasenkarzinoms ist, ist es daher besonders wichtig, auf mögliche Symptome zu achten und unverzüglich ärztlichen Rat zu suchen.
Blasenkrebs geht überwiegend von der Blasenschleimhaut aus und seine Entstehung wird durch eine Reihe von Risikofaktoren begünstigt.
Der wichtigste Hinweis auf Blasenkrebs ist Blut im Urin.
Zur Diagnostik werden in erster Linie die Blasenspiegelung (Zystoskopie) mit Entnahme einer Gewebeprobe für die feingewebliche Untersuchung und die Ultraschalluntersuchung (Sonografie) eingesetzt. Bei Verdacht auf eine weiter fortgeschrittene Erkrankung werden Ihre Ärzt:innen weitere Untersuchungen veranlassen.
Sowohl die Prognose als auch die Behandlung des Harnblasenkarzinoms hängen von der Ausbreitung (Stadium) und der Aggressivität des Tumors ab.
Zur Therapie stehen den Ärzt:innen verschiedene medikamentöse und chirurgische Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Frühstadium ist Blasenkrebs meist sehr gut behandelbar und das Ziel der Behandlung ist die Heilung. Hat sich der Tumor schon weit ausgebreitet, dann ist meist keine Heilung mehr möglich und die Behandlung zielt darauf ab, den Patient:innen möglichst lang eine Krankheitskontrolle und Verringerung der Beschwerden bei guter Lebensqualität zu ermöglichen.12
Auch wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist, kann durch eine individuelle, auf den jeweiligen Fall abgestimmte Behandlung eine gute Krankheitskontrolle und Verringerung der Beschwerden erreicht werden – dies auch aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts und der Präzisionsmedizin.
Entstehung & Risikofaktoren
Wie entsteht Blasenkrebs?
Blasenkrebs geht überwiegend von Gewebe aus, das die Hohlräume von Nierenbecken, Harnleiter und einen Teil der Harnröhre auskleidet (Urothel). Bösartige Tumore, die aus diesem Gewebe entstehen, gehören daher zu den Urothelkarzinomen. Häufigstes Urothelkarzinom ist der Blasenkrebs.3
Wichtig ist zu wissen, welche Form von Harnblasenkrebs vorliegt, vor allem, ob der Tumor auf das Urothel der Blase begrenzt ist oder bereits in die Muskelschicht hineingewachsen ist. Denn je nach Krebsform unterscheiden sich die Behandlung und der Verlauf der Erkrankung.34

Was sind die Ursachen von Blasenkrebs?
Die genauen Ursachen von Blasenkrebs sind unbekannt. Grundsätzlich entsteht Krebs, wenn sich eine gesunde Zelle so verändert, dass sie beginnt, sich stark zu vermehren. Diesem Prozess können viele Gründe zugrunde liegen. Dazu zählen etwa Schäden am Erbgut der Zellen oder Fehler beim Ablesen der Erbinformation.
Mit der Zeit entstehen mehr neue Krebszellen als alte Zellen absterben. Bösartige Zellen wachsen dann zu einer Geschwulst (Tumor) heran. Im Gegensatz zu normalen Zellen können Krebszellen in gesundes Gewebe einwachsen, es zerstören und sich im Körper weiter ausbreiten.34
Gibt es Risikofaktoren für Blasenkrebs?
Neben dem höheren Lebensalter und dem männlichen Geschlecht gibt es weitere Faktoren, die Blasenkrebs fördern. Blasenkrebs kann aber selbst dann entstehen, wenn kein Risikofaktor bekannt ist.34
- Tabakrauchen ist der wichtigste Risikofaktor
- Bestimmte Chemikalien, wie z. B. aromatische Amine
- Bestimmte Medikamente, z. B. das Chemotherapeutikum Cyclophosphamid
- Wiederholte oder chronische Blasenentzündungen mit Schädigung der Blasenschleimhaut
- Nach einer Strahlenbehandlung im Bereich des Beckens, z. B. bei Prostatakrebs
Berufsgruppen mit erhöhtem Risiko
Bei manchen Berufsgruppen ist das Risiko für Blasenkrebs erhöht. Dazu gehören Menschen, die mit bestimmten chemischen Stoffen oder Verbrennungsprodukten Kontakt haben, z. B. Maler:innen und Lackierer:innen, Straßenbauarbeiter:innen, Schornsteinfeger:innen, aber auch Menschen, die in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie arbeiten.
Blasenkrebs kann in solchen Fällen als Berufskrankheit anerkannt werden.3
Blasenkrebs erkennen
Anzeichen und Symptome von Blasenkrebs
Leider gibt es keine sicheren Hinweise auf Blasenkrebs. Anfangs verursacht die Erkrankung häufig überhaupt keine Beschwerden oder sehr allgemeine und unspezifische Symptome, die man auch bei anderen Erkrankungen der Blase und der Harnwege findet.235 Bei Frauen denkt man vielleicht eher an eine Blasenentzündung, bei Männern an Prostataprobleme.2
Die häufigsten Symptome bei Blasenkrebs sind45
- Erste Warnhinweise können Blut im Urin, meist ohne Schmerzen, und Beschwerden beim Harnabsatz, wie verstärkter Harndrang und Blasenentleerungsstörungen sein. Auch Gefühle einer Blasenentzündung können auftreten.
- Bei weiter fortgeschrittener Erkrankung können Schmerzen im unteren Bauch, in der Nierengegend sowie Knochenschmerzen auftreten.
Gehen Sie möglichst bald zu Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt, wenn Sie Blut im Urin bzw. eine rötliche oder bräunliche Verfärbung des Urins oder Beschwerden beim Wasserlassen bemerken.
Wie wird Blasenkrebs diagnostiziert
Anamnese
Bei einem Verdacht auf ein Harnblasenkarzinom wird Sie Ihre Ärztin oder Ihr Arzt zuerst genau nach Ihren Beschwerden und Ihrer Krankengeschichte fragen. Dazu gehören auch Fragen, ob Sie rauchen, ob Sie bestimmte Schmerzmittel eingenommen haben oder früher (beruflich) Kontakt mit verschiedenen Chemikalien hatten.
Urinuntersuchung
Der frische Urin wird auf das Vorhandensein von Zellen und Blut untersucht.
Ultraschalluntersuchung (Sonografie)
Mit der Sonografie der ableitenden Harnwege und der Blase können die Ärzt:innen sehen, ob ein Harnstau vorliegt oder ob möglicherweise Harnsteine die Ursache für das Blut im Urin sein können.
Blasenspiegelung (Zystoskopie)
Mit der Zystoskopie, einer schmerzlosen Untersuchung, können die Ärzt:innen die Blase von innen sehen. Dazu wird ein kleines Endoskop mit einer Kamera an der Spitze unter örtlicher Betäubung durch die Harnröhre in die Blase eingeführt. Die von der Kamera aufgenommenen Bilder werden auf einen Monitor übertragen, so können die Ärzt:innen Schleimhautveränderungen sehen.
Bei der Blasenspiegelung werden Gewebeproben (Biopsien) für die histologische Untersuchung entnommen. Kleinere tumorverdächtige Veränderungen können sogar während einer Blasenspiegelung vollständig entfernt werden. Dieses Verfahren nennt man transurethrale Resektion des Blasengewebes, abgekürzt TUR-B oder auch nur TUR.
Bei nicht invasivem Blasenkrebs, d. h. auf die Schleimhaut begrenztem Blasenkrebs, ohne Risikofaktoren werden keine weiteren Untersuchungen durchgeführt.245
Weitere Untersuchungen
Bei erhöhtem Rückfallrisiko oder bei Verdacht auf muskelinvasiven Blasenkrebs werden die Ärzt:innen weitere Untersuchungen durchführen oder veranlassen, um zu beurteilen, ob oder wie weit sich der Krebs ausgebreitet hat.245
- Laboruntersuchungen des Blutes
- Sog. bildgebende Untersuchungen wie Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT) und Röntgenuntersuchungen zur Darstellung der Harnausscheidung sowie des Bauch- und Brustraums und des Beckens
- Bei Verdacht auf Hirnmetastasen erfolgt eine Computertomografie des Kopfes, bei Verdacht auf Knochenmetastasen eine Skelettszintigrafie (nuklearmedizinische Untersuchung des Skeletts).
Krankheitsverlauf
Welche Stadien von Blasenkrebs gibt es und wie ist der Verlauf?
Mod. nach Castaneda P, et al. 20236
Stadium entscheidet über die Wahl der Behandlung
Grundlage für die Definition des Tumorstadiums ist die Ausbreitung des Tumors, d. h. ob der Krebs auf die Schleimhaut beschränkt ist oder bereits in die Muskelschicht der Blasenwand oder sogar darüber hinaus in benachbarte Organe eingewachsen ist.
Nicht (muskel)invasiver Blasenkrebs
Bei 75 % der Betroffenen wird Blasenkrebs im Frühstadium diagnostiziert. Frühstadium bedeutet, dass der Krebs auf die Blasenschleimhaut begrenzt ist und noch nicht in die darunter liegende Muskulatur der Blasenwand eingedrungen ist.6
Der nicht muskelinvasive Blasenkrebs ist in der Regel gut behandelbar. Jedoch besteht das Risiko, dass es zu einem Rückfall kommt oder die Erkrankung zu einem muskelinvasiven Blasenkarzinom fortschreitet (Progression).5 Dieses Risiko hängt u. a. von der Anzahl und Ausdehnung der vorliegenden Tumoren und der Aggressivität des Tumors (Grading) ab, und die Patient:innen werden in 3 Risikogruppen eingeteilt, nach denen sich die Wahl der Behandlung richtet: niedriges (low risk), mittleres (intermediate risk) und hohes Risiko (high risk).6
Muskelinvasiver Blasenkrebs
Krebs, der bereits in die Muskelschicht der Harnblasenwand eingewachsen ist, wird als muskelinvasiver Blasenkrebs bezeichnet. In diesem Stadium kann der Krebs auch schon die Blasenwand durchbrochen und sich auf Nachbarorgane ausgebreitet haben.
Beim muskelinvasiven Harnblasenkarzinom besteht ein erhöhtes Risiko für einen Rückfall nach der Behandlung oder für ein Fortschreiten zum metastasierten Stadium.6 In diesem Stadium müssen die Ärzt:innen meist die Harnblase meistens komplett entfernen und eine künstliche Harnableitung schaffen. Auch das vom Krebs betroffene angrenzende Gewebe muss entfernt werden.45
Metastasierter Blasenkrebs
Im metastasierten (oder metastasierenden) Stadium hat der Krebs „gestreut“. Krebszellen sind über die Blut- und Lymphbahnen in andere, entfernte Organe eingedrungen: in Lymphknoten, Leber, Lunge oder die Knochen, seltener auch ins Gehirn. Dort wachsen sie und bilden Tochtergeschwülste, sogenannte Metastasen. In diesem Stadium kann der Blasenkrebs nicht mehr komplett entfernt und geheilt werden. Mit Medikamenten und Strahlentherapie können die Beschwerden jedoch verringert und die Erkrankung für einige Zeit kontrolliert werden.47
Wie sind die Heilungsaussichten beim Blasenkarzinom? Ist Blasenkrebs heilbar?
Die Prognose von Patient:innen mit Blasenkrebs hängt in erster Linie vom Stadium und der Aggressivität (Grading) des Tumors ab, des Weiteren von Alter, Fitness und Geschlecht sowie von Begleiterkrankungen.7 Mit der Entwicklung zielgerichteter Therapien könnte auch der Nachweis bestimmter Biomarker in Zukunft Aussagen über die Prognose zulassen. Als möglicherweise relevant diskutiert werden für invasive Blasentumoren unter anderem Mutationen in den Genen FGFR, CDKN2A, PPARG, ERBB2, E2F3, TP53 und RB1diskutiert.8 Diese Gene sind auf verschiedene Weise an der Regulation des Wachstums, der Differenzierung und der Vermehrung von Blasenkrebszellen beteiligt. Im Falle einer Mutation können sie ihre Aufgaben nicht mehr korrekt erfüllen.
Der Nachweis von Biomarkern könnte den Ärzt:innen dabei helfen, die Eigenschaften einer Krebserkrankung besser zu verstehen und gegebenenfalls die Behandlung noch individueller auf die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten zuzuschneiden. Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, ob eine Biomarker-Bestimmung in Ihrem Fall sinnvoll ist.
Prognose von Patient:innen mit Blasenkrebs
Im Frühstadium (nicht muskelinvasiver Blasenkrebs) ist die Prognose am besten, hier sind nach 5 Jahren noch über 95 % der Patient:innen am Leben, die meisten von ihnen gelten als geheilt. In höheren Stadien nimmt der Anteil der Patient:innen ab, die nach 5 Jahren noch leben.9
modifiziert nach 9
Behandlung und Nachsorge von Blasenkrebs
Wie wird Blasenkrebs behandelt?
Individuelle Behandlung je nach Patient:in und Situation
Die Behandlung des Harnblasenkarzinoms richtet sich danach, wie weit sich der Krebs schon ausgebreitet hat (Tumorstadium), der Aggressivität des Tumors (Grading) und dem Risiko eines Rückfalls oder der Progression.45
Möglichkeiten der Blasenkrebsbehandlung in den verschiedenen Krebsstadien

Modifiziert nach 4
Das Behandlungsziel bei nicht invasiven Blasenkarzinomen ist die Heilung. Auf die Blasenschleimhaut begrenzte oberflächliche Blasentumoren können häufig endoskopisch im Rahmen einer Zystoskopie entfernt werden. Man nennt diesen Eingriff transurethrale Resektion der Blase (TUR, TUR-B). Die Blase bleibt dabei erhalten. Nach dem Eingriff erfolgt eine örtliche (lokale) Behandlung – Blasenspülung(en) mit Chemotherapie-Medikamenten oder Medikamenten, die das Immunsystem anregen, um das Rückfallrisiko zu senken.23
Bei muskelinvasivem Blasenkrebs sind die Krebszellen schon in die tieferen Schichten der Blasenwand eingewachsen oder haben diese sogar durchbrochen und sich auf benachbarte Gewebe und Organe ausgebreitet. Auch bei muskelinvasivem Blasenkrebs zielt die Behandlung auf Heilung ab. In diesem Stadium wird i. d. R. die Harnblase komplett entfernt, einschließlich der benachbarten Gewebe und Organe (radikale Zystektomie). Zur Senkung des Rückfallrisikos erhalten die Patient:innen oft zusätzlich eine Chemotherapie – entweder vor der Operation (neoadjuvante Chemotherapie) oder nach der Operation (adjuvante Chemotherapie). Zunehmend werden auch immunonkologische Wirkstoffe für die adjuvante Therapie eingesetzt.10
Wenn der Blasenkrebs sich auf andere, weiter entfernte Organe ausgebreitet hat, ist eine Heilung nicht mehr wahrscheinlich. Mit der medikamentösen Behandlung – Chemotherapie, immunonkologische und zielgerichtete Therapien – versuchen die Ärzt:innen jetzt, die Erkrankung zu kontrollieren, Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten.345
In besonderen Fällen können die Ärzt:innen die Blase bei muskelinvasivem Blasenkrebs erhalten. Dies sind beispielsweise hochbetagte Patient:innen mit einem hohen Operationsrisiko bei radikaler Blasenentfernung oder Patient:innen, die eine Erhaltung der Blase wünschen. Sie erhalten dann eine TUR und anschließend eine kombinierte Strahlen- und Chemotherapie (Radiochemotherapie).
Welche Behandlungsverfahren kommen zum Einsatz?
Grundsätzlich stehen den Ärzt:innen mehrere Verfahren zur Behandlung von Blasenkrebs zur Verfügung, die sie je nach dem Stadium der Erkrankung, der Aggressivität des Tumors und dem Risiko eines Rückfalls oder des Fortschreitens der Erkrankung einsetzen.2345
Im Frühstadium oft ausreichend: transurethrale Resektion von Blasengewebe (TUR, TUR - B)
Die transurethrale Resektion von Blasengewebe (TUR, TUR-B) ist Teil der Diagnostik der Blasenkarzinome. Bei kleineren Blasentumoren, die auf die Blasenschleimhaut begrenzt sind, kann sie auch gleichzeitig die Behandlung darstellen: Wenn das Tumorgewebe noch nicht in die tieferen Schichten der Blasenwand eingewachsen ist, kann es mit der TUR während einer Blasenspiegelung entfernt werden.
Die TUR-B wird in lokaler Betäubung oder in Voll- oder Teilnarkose durchgeführt. Die Ärzt:innen führen durch die Harnröhre ein Endoskop in die Blase ein und tragen den Tumor unter Sicht mit einer Elektroschlinge ab. Das Tumorgewebe wird histologisch untersucht, um zu beurteilen, ob die Schnittränder frei von Krebszellen sind, wie aggressiv ihr Wachstum ist und welche weiteren Charakteristika sie aufweisen.
Manchmal ist eine zweite TUR, eine sog. Nachresektion erforderlich, um das Rückfall- oder Progressionsrisiko zu verringern, u. a. wenn die Schnittränder nicht sicher frei von Krebszellen sind oder der Tumor ein besonders aggressives Wachstum aufweist. Die Nachresektion wird etwa 2 bis 6 Wochen nach der ersten TUR durchgeführt.24571011
Kann einem Rückfall vorbeugen: lokale Chemo- und Immuntherapie (Instillationstherapie)
Um das Risiko für einen Rückfall zu verringern, wird nach der TUR eine sogenannte Instillationstherapie empfohlen. Dazu wird über einen Blasenkatheter ein Zytostatikum oder ein Medikament, das die Immunabwehr anregen soll (BCG, Bacillus Calmette-Guérin), in die Blase eingebracht. Häufigkeit und Dauer der Instillationstherapie sind abhängig vom individuellen Rückfallrisiko.245710
Operation: Entfernung der Harnblase (Zystektomie)
Beim muskelinvasiven Harnblasenkrebs wird in den meisten Fällen die Blase mitsamt den zugehörigen Lymphknoten sowie benachbarten Geweben und Organen entfernt (radikale Zystektomie). Bei Frauen werden i. d. R. Teile der Scheidenwand sowie Eierstöcke, Eileiter und Gebärmutter, bei Männern die Prostata und die Samenblasendrüsen mit entfernt.4
Im metastasierten Stadium besteht die Möglichkeit einer Zystektomie zur Linderung von Beschwerden.4
Die radikale Blasenentfernung kann heute auch als sog. Schlüsselloch-Operation (minimal-invasiv; häufig roboterassistiert) durchgeführt werden. Dabei ist kein einzelner großer Bauchschnitt nötig, sondern mehrere kleine, über die Kamera und Instrumente in den Bauchraum eingeführt werden. Der Schlüsselloch-Eingriff ist noch nicht als Standardverfahren etabliert.11
Gleichzeitig mit der Entfernung der Harnblase muss eine neue Möglichkeit der Harnableitung geschaffen werden.345
Nebenwirkungen und Komplikationen der Zystektomie
Bei der Zystektomie können Nebenwirkungen auftreten. So kann es wie bei anderen Operationen u. a. zu Blutungen, Wundinfektionen, Herz-Kreislauf-Problemen oder Blutgerinnseln (Thrombosen) kommen.
Direkt mit der Entfernung der Blase im Zusammenhang stehen Probleme mit der künstlichen Harnableitung, außerdem Zeugungsunfähigkeit und Erektionsprobleme bei Männern. Wenn bei Frauen im gebärfähigen Alter die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt werden, können sie keine Kinder mehr bekommen, bei Entfernung der Eierstöcke kommt es zu plötzlichen Wechseljahresbeschwerden.345
Künstliche Harnableitung nach Harnblasenentfernung
Wenn die Harnblase entfernt wird, schaffen die Operateur:innen bei der Zystektomie einen neue Möglichkeit, den Harn zu sammeln und aus dem Körper auszuleiten. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr Behandlungsteam wird diese mit Ihnen besprechen und zusammen mit Ihnen das für Sie passende Vorgehen auswählen:
Bei der trockenen oder kontinenten Harnableitung345 wird der Harn in einem neu geschaffenen Reservoir im Körper gesammelt und von da abgeleitet. Die Patient:innen können bei dieser Form der Harnableitung den Harnabgang mehr oder weniger selbst kontrollieren, jedoch spüren sie nicht, wann die Ersatzblase voll ist. Zu den trockenen Harnableitungen gehören
- die Neoblase: Sie wird aus einen Darmstück gebildet und mit Harnleitern und Harnröhre verbunden.
- der Pouch: Dieser wird ebenfalls aus Darmgewebe geformt wie die Neoblase, der Urin wird jedoch über einen künstlichen Blasenausgang (Stoma) in der Bauchdecke abgeleitet.
Bei der nassen oder inkontinenten Harnableitung345 dagegen fließt der Urin kontinuierlich aus den Harnleitern zu einer Öffnung in der Bauchdecke in einen Beutel. Auch hier gibt es 2 Möglichkeiten:
- das (Ileum-)Conduit
- die Harnleiter-Haut-Fistel
Risiken und Komplikationen der künstlichen Harnableitung
Bei der künstlichen Harnableitung sind verschiedene Komplikationen möglich, beispielsweise Inkontinenz oder Entleerungsprobleme bei einer Neoblase oder einem Pouch, Harnwegsinfektionen, Hautveränderungen im Bereich des Stomas, Schleimbildung in der Neoblase, Vernarbungen und Verengungen und weitere Komplikationen wie Fieber, Harnstein-Bildung, Veränderungen des Säure-Basen-Haushalts oder ein sogenanntes Kurzdarm-Syndrom.34512
Wichtig zu wissen!
Der Umgang mit einer künstlichen Harnableitung muss erlernt und trainiert werden. Ihr Behandlungsteam wird Sie unterstützen, damit Sie sich schnell an die neue Situation und die Anforderungen, die durch die künstliche Harnableitung auf Sie zukommen, gewöhnen.
Auch der Austausch mit anderen Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe, die bereits Erfahrungen mit einer künstlichen Harnableitung gesammelt haben, kann Ihnen weiterhelfen.
Chemotherapie
Häufig empfehlen Ärzt:innen Patient:innen mit Blasenkrebs eine Chemotherapie – entweder unterstützend als neoadjuvante oder adjuvante Chemotherapie für den Fall, dass durch die Operation nicht alle Krebszellen entfernt werden konnten, oder zur Linderung und Kontrolle von Beschwerden, wenn der Krebs bereits gestreut und Tochtergeschwülste in anderen Organen gebildet hat.45
Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über Wirkweise und Nebenwirkungen der Chemotherapie.
Chemotherapie bei muskelinvasivem Blasenkrebs
Bei Patient:innen mit muskelinvasivem Blasenkrebs sollte eine Chemotherapie vor der Operation (neoadjuvante Chemotherapie) oder danach (adjuvante Chemotherapie) erwogen werden, um Krebszellen im Körper abzutöten.710
Chemotherapie bei metastasiertem Blasenkrebs
Bei metastasiertem Harnblasenkarzinom ist im Allgemeinen keine Heilung mehr möglich. Hier hat die Chemotherapie das Ziel, Beschwerden zu lindern, das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern und das Überleben bei guter Lebensqualität zu verlängern. Man nennt das „palliative“ Therapie. Ärzt:innen empfehlen in der Regel eine Kombinationschemotherapie, von denen einer der Wirkstoffe nach Möglichkeit ein Platin-Abkömmling sein sollte (platinbasierte Chemotherapie). Welche weiteren Wirkstoffe kombiniert oder als Einzelbehandlung eingesetzt werden, entscheiden die Ärzt:innen individuell nach dem Allgemeinzustand der Patient:innen.710
Immunonkologische Therapie beim Harnblasenkarzinom
Seit einigen Jahren besteht für Patient:innen mit Blasenkarzinomen die Möglichkeit einer immunonkologischen Therapie mit Checkpoint-Inhibitoren, wenn ihre Krebszellen einen bestimmten Biomarker (PD-L1) aufweisen. Checkpoint-Inhibitoren aktivieren das Immunsystem zur Bekämpfung der Tumorzellen. Diese Medikamente werden als adjuvante Therapie nach einer Entfernung der Blase eingesetzt sowie bei metastasierten Blasenkarzinomen, wenn eine vorherige Chemotherapie nicht oder nicht mehr wirksam war.71013
Innovative zielgerichtete Therapien
In Studien werden Medikamente unterschiedlicher Stoffklassen, z. B. Antikörper, Antihormone oder sogenannte kleine Moleküle, auf ihre Wirksamkeit, oder auch Wirkstoffkombinationen bei metastasiertem Blasenkrebs untersucht. Die Forschung konzentriert sich darauf, Medikamente zu entwickeln, die gezielt Krebszellen mit bestimmten Eigenschaften angreifen, wie zum Beispiel Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC). Sie bestehen aus einem Antikörper, der gezielt an eine Krebszelle bindet. An den Antikörper ist ein Chemotherapie-Medikament, ein sog. Zytostatikum, gekoppelt, das die Krebszellen gezielt zerstört. So werden gesunde Körperzellen weniger beeinträchtigt.14
ADC sind bereits bei einigen Krebserkrankungen im Einsatz, weitere werden erforscht.
Lesen Sie mehr über zielgerichtete Therapien und Präzisionsmedizin.
Weitere Behandlungen bei Blasenkrebs
Behandlung von Knochenmetastasen
Wenn sich das Blasenkarzinom in einem späten Stadium auf die Knochen ausgebreitet hat, können Knochenbrüche und Schmerzen auftreten. Bei Beschwerden durch Knochenmetastasen kann Ihr Behandlungsteam Ihnen verschiedene Behandlungen anbieten: Schmerzmedikamente, Bestrahlung oder Operation der Metastasen, Medikamente zur Stärkung des Knochens.4
Entfernung der Blase bei Beschwerden
Wenn das Blasenkarzinom stark in seine Umgebung eingewachsen ist, können massive örtliche Beschwerden die Folge sein – Rückstau des Harns bis in die Nieren, Schmerzen, Blutungen oder auch Fisteln zwischen Blase und Darm. Wenn die Beschwerden trotz anderer Maßnahmen nicht erfolgreich gebessert werden, können Ihre Ärzt:innen die Blase entfernen, wenn Ihr Gesundheitszustand den Eingriff zulässt.4
Supportivtherapie
Eine Krebserkrankung belastet den Körper massiv – ebenso wie ihre Behandlung. Mit einer unterstützenden Therapie (Supportivtherapie) behandeln die Ärzt:innen die allgemeinen Auswirkungen der Krebserkrankung wie Müdigkeit oder Schmerzen und die Folgen der Krebsbehandlung.4

Palliative Behandlung am Lebensende
Ist der Blasenkrebs so weit fortgeschritten, dass er nicht mehr heilbar ist, kann die palliative Behandlung die Patient:innen begleiten und ihnen in der ihnen verbleibenden Zeit ein gutes Leben ermöglichen. Hauptziel der palliativmedizinischen Begleitung ist es, die Lebensqualität der Patient:innen, aber auch die ihrer Angehörigen und Nächsten zu erhalten und zu verbessern. Sie soll vordringlich körperliche Beschwerden lindern, insbesondere Schmerzen, und sich daneben der seelischen und sozialen Probleme der Patient:innen annehmen.4
Lesen Sie hier mehr zur Palliativmedizin am Lebensende.
So geht es nach der Behandlung weiter: Nachsorge nach der Blasenkrebsbehandlung
Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, werden Ihre Ärzt:innen Sie regelmäßig nachuntersuchen. Die Nachsorge findet anfangs in kürzeren, mit der Zeit in längeren Abständen statt. Bitte nehmen Sie die Untersuchungstermine auf jeden Fall wahr, denn die Nachsorgeuntersuchungen helfen dabei, einen Rückfall oder eine Progression sowie Behandlungsfolgen frühzeitig zu erkennen.45
Häufigkeit und Abstände sowie angewendete Verfahren der Nachsorgeuntersuchungen orientieren sich am Krankheitsstadium sowie am Rückfallrisiko der Patient:innen. Wichtigste Nachsorgeuntersuchung ist die Blasenspiegelung. Zur Nachsorge gehören zusätzlich Urin- und Blutuntersuchungen sowie bei hohem Risiko bzw. bei muskelinvasivem Harnblasenkarzinom auch bildgebende Verfahren.710
Rehabilitation
Die Belastungen durch eine Krebserkrankung und die Behandlung sind immens. Körperlich und seelisch wird den Betroffenen sehr viel abverlangt. So kann die Therapie eines Harnblasenkarzinoms zu Beeinträchtigungen führen, die das ganze weitere Leben verändern. Eine onkologische Rehabilitation („Reha“) kann Ihnen dabei helfen, die Folgen der Krebserkrankung sowie der Krebstherapie zu verringern. Die Ziele einer onkologischen Reha werden dabei ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Deswegen sollten Sie am besten eine Reha-Klinik mit Expertise bei urologischen Krebserkrankungen, insbesondere Blasenkrebs auswählen.
Im Zentrum der Rehabilitation stehen u. a.
- Umgang mit Inkontinenz und mit der künstlichen Harnableitung nach Blasenentfernung
- Sexuelle Probleme
- Körperliche und seelische Folgen der Krebserkrankung und ihrer Behandlung
- Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den Beruf
Die Rehabilitation kann ambulant oder stationär erfolgen, sie ist auch als Anschlussrehabilitation gleich nach dem Krankenhausaufenthalt sinnvoll und möglich. Was für Sie in Frage kommt, hängt von Ihrem körperlichen Zustand nach dem Krankenhausaufenthalt und der Erreichbarkeit ambulanter Reha-Einrichtungen ab. Die Sozialdienste der Krankenhäuser unterstützen Sie bereits während Ihres stationären Aufenthalts bei der Stellung des Reha-Antrags.4515

Leben mit Harnblasenkrebs
Krebs verändert das Leben der Betroffenen schlagartig. Auch das Leben ihrer Angehörigen und Freunde. Geben Sie sich Zeit, mit der neuen Situation zurechtzukommen und zu lernen, mit der Krebserkrankung umzugehen. Auch Wissen hilft mit dazu, die Erkrankung und ihre Folgen zu bewältigen.
Grundsätzlich haben Krebspatient:innen und ihre Angehörigen einen Anspruch auf psychoonkologische Unterstützung. Die Krankenkassen übernehmen in der Regel die Kosten dafür. Fragen Sie Ihr Behandlungsteam danach. Lesen Sie mehr zu Psyche & Krebs.
Spezielle Probleme bei Blasenkrebs
Nach Entfernung der Blase und Anlage der künstlichen Harnableitung kann es zu einer Reihe von Belastungen kommen: Inkontinenz, Harnwegsinfektionen, Erektionsprobleme, Veränderungen des Körperbilds, Schädigung der Haut im Bereich des Urostomas, möglicherweise Harnsteinbildung, Störung des Säure-Basen-Haushalts, Vitamin-B-Mangel. Sie haben Auswirkungen auf das Berufsleben, Freizeitaktivitäten, das Sexualleben, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, aber auch auf Ernährung oder Sport. Manchmal könne die Belastungen sogar bis zu einer Depression führen.4
Bitte denken Sie daran: Sie sind nicht allein mit Ihren Problemen! Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihr Behandlungsteam. Auch weitere Fachleute wie Psychotherapeut:innen, Paar- und Sexualtherapeut:innen, Stomatherapeut:innen, Ernährungsberater:innen können Ihnen im Einzelfall weiterhelfen.4
Thomas-Mann-Straße 40 53111 Bonn
Telefon: 0228 33889150
Telefax: 0228 33889155
E-Mail: info@blasenkrebs-shb.de
Internet: www.blasenkrebs-shb.de
Hilfreicher Kontakt mit anderen Betroffenen: Selbsthilfe
Auch Selbsthilfe-Organisationen wie der Selbsthilfe-Bund Blasenkrebs e. V. können Ihnen helfen, mit den Belastungen durch Blasenkrebs und seine Behandlung zurechtzukommen. In Selbsthilfegruppen bleiben Sie mit Ihren Fragen und Problemen nicht allein, sondern können Sie sich mit ebenfalls Betroffenen austauschen.
Wo Sie eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Nähe finden, können Sie unter www.blasenkrebs-shb.de/selbsthilfe oder telefonisch unter 0228 33889150 erfragen.
Fortschritte in der Blasenkrebstherapie
Präzisionsmedizin und aktuelle Forschung
Die Forschung im Bereich der Erkennung und Behandlung von Krebserkrankungen entwickelt sich rasant. Von dieser Entwicklung profitieren auch Patient:innen mit Blasenkrebs. In den letzten Jahren wurden neue Behandlungsmöglichkeiten entdeckt, die die Versorgung und nicht zuletzt die Heilungschancen von Betroffenen verbessern können. Dazu zählen etwa zielgerichtete Therapien wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) und Immuntherapien, aber auch bestimmte Operationen oder die Strahlentherapie.
Die Teilnahme an einer klinischen Studie bedeutet für diejenigen Patient:innen eine Perspektive, bei denen bisher bekannte Therapien nicht mehr oder nicht ausreichend wirken. Im Rahmen einer Studie können sie so mit neuen Medikamenten therapiert werden, ihre Prognose verbessern und zum Fortschritt in der Medizin beitragen.
Präzisionsmedizin ist auf dem Weg, die Behandlung von Patienten mit einer Krebserkrankung zu revolutionieren. Das Grundprinzip lautet: Wende die richtige Behandlung zum richtigen Zeitpunkt beim/bei der richtigen Patient:in an. Diese innovative Herangehensweise beruht auf den genetischen und molekularen Eigenschaften eines jeden einzelnen Tumors und einer:s jeden einzelnen Patient:in. Anstatt alle Betroffenen gleich zu behandeln, können Ärztinnen und Ärzte durch präzise Analysen ermitteln, welche Behandlung am besten auf die spezifischen Merkmale einer Person zugeschnitten ist.1617

Bestrahlung: Hochenergetische Strahlen zerstören Krebszellen
Chemotherapie: Medikamente greifen Krebs an
Chirurgie: Operation entfernt oder verkleinert Krebs

personalisierte Behandlung
Molekularbiologie: Erkennt krebsverursachende Gene und Biomarker
Immuntherapien: Personalisierte Behandlung durch Aktivierung von Immunzellen
Zielgerichtete Therapien: Blockieren krebsspezifische Strukturen
Dabei kann Präzisionsmedizin nicht nur dazu beitragen, den Krankheitsverlauf abzuschätzen und die Behandlung zu verbessern, sondern auch potenzielle Nebenwirkungen zu minimieren. Diese individuellen Merkmale sind z. B. bestimmte Eiweiße, die in Körperflüssigkeiten wie Urin oder Blut gemessen werden oder Veränderungen von Erbmaterial im Tumor selbst, die den charakteristischen „Fußabdruck“ dieses einen Tumors umschreiben.17
Insgesamt erhofft man sich, dass die Präzisionsmedizin auch für Patient:innen mit Blasenkrebs eine maßgeschneiderte und wirksame Behandlung ermöglicht, die nicht nur die Überlebensaussichten verbessert, sondern auch die Lebensqualität erhöht.
Häufig gestellte Fragen
Welche Ärzt:innen behandeln Blasenkrebs?
Bei der Diagnostik und Behandlung Ihres Blasenkarzinoms arbeiten Ärzt:innen verschiedener Fachrichtungen eng zusammen: Hausärzt:innen, Urolog:innen, Patholog:innen, Radiolog:innen (Röntgenärzt:innen), Strahlentherapeut:innen, Onkolog:innen, Rehabilitationsmediziner:innen, außerdem Psychoonkolog:innen.4
Welche Blutwerte sind bei Blasenkrebs erhöht?
Blutuntersuchungen werden zur Entdeckung von Blasenkrebs nicht empfohlen, da es keine für Blasenkrebs typischen Veränderungen gibt. Im Blut gibt es bislang auch keine aussagekräftigen Tumormarker, die auf Blasenkrebs hinweisen könnten.45
Welche neuen Behandlungsmethoden bei Blasenkrebs gibt es?
Seit einigen Jahren kann das fortgeschrittene und metastasierte Blasenkarzinom in bestimmten Fällen immunonkologisch mit Checkpoint-Inhibitoren behandelt werden.710 Darüber hinaus wird an Substanzen geforscht, die gezielt gegen Eigenschaften der Blasenkrebszellen wirken, in die Kommunikation der Krebszellen eingreifen oder die ein Chemotherapie-Medikament gezielt zu den Krebszellen transportieren, wie z. B. Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC).
Wie schnell wächst Blasenkrebs?
Blasenkrebs wächst im Allgemeinen langsam. Oft dauert es Jahre bis die ersten Anzeichen auftreten.18
Wie kann die Frauenärztin Blasenkrebs feststellen?
Ärzt:innen können mit einem Teststreifen Urin auf Blutspuren untersuchen: Bei Beschwerden/Problemen im Bereich der Blase oder der Harnwege sollte jedoch eine Urologin/ein Urologe aufgesucht werden.
„Derzeit existiert jedoch kein Diagnosetest, der in Lage ist, im Urin das Vorhandensein eines Blasenkrebs mit ausreichender Sicherheit nachzuweisen. Daher wird eine Verwendung von kommerziell erhältlichen Urintests als Screening- oder Vorsorgeuntersuchung nicht empfohlen. (Deutsche Krebsgesellschaft)
Wie kann man Blasenkrebs vorbeugen?
Das Risiko für Blasenkrebs können Sie hauptsächlich verringern, wenn Sie aufhören zu rauchen. Eine ausgewogene pflanzenbasierte Ernährung ist für die allgemeine Gesundheit gut und sie könnte möglicherweise vor Krebs schützen. Es gibt einige Hinweise dafür, dass eine hohe Flüssigkeitsaufnahme (insbesondere Wasseraufnahme) das Risiko für Blasenkrebs senken könnte.11
Wie soll ich mich bei/nach Blasenkrebs ernähren?
Eine besondere „Diät“ bei Blasenkrebs gibt es nicht. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Obst, Vollkornprodukten, pflanzlichen Fetten tut allen gut – auch Krebspatient:innen.45
Das könnte Sie auch interessieren

Sie sind an Krebs erkrankt oder stehen einer betroffenen Person nahe? Dabei haben Sie Fragen rund um die Erkrankung, die nach dem ärztlichen Gespräch offengeblieben sind und auch auf diesen Seiten nicht beantwortet werden? Hier können Sie Ihre Fragen einfach und anonym stellen und erhalten fachlich fundierte Antworten in wenigen Tagen.
Nützliche Links, die Ihnen weiterhelfen
Broschüren und Informationsmaterial für Betroffene und Angehörige finden Sie hier.
Dieser Text entspricht den redaktionellen Standards der JanssenWithMe und wurde von Franziska Dillner, einem Mitglied des redaktionellen Beirats, geprüft. Lernen Sie hier den medizinischen Beirat unserer Redaktion kennen.
EM-150081
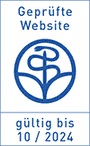
Das Gütesiegel bestätigt die gutachterliche Prüfung der Website im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens der Stiftung Gesundheit. Es stellt sicher, dass Gesundheitsinformationen in qualifizierter Weise zur Verfügung stehen und somit die Transparenz für Patient:innen fördert.
EM-142857
