Prostata-Vorsorge zur Früherkennung von Prostatakrebs
Deine Manndeckung:
die Aufklärungsinitiative
für Prostatakrebs

Prostata-Vorsorge zur Früherkennung von Prostatakrebs
Für Männer ist Prostatakrebs ein Thema, über das sie sich am liebsten keine Gedanken machen. Schon gar nicht über die Früherkennung. Geht dir das auch so? Die Initiative Deine Manndeckung hilft dir dabei, das zu ändern: Hier wird Klartext gesprochen, mit Tabus aufgeräumt.
Lass dich über die Vor- und Nachteile der Früherkennungsmaßnahmen im Rahmen der Krebsvorsorge sowie die verschiedenen Untersuchungen der Prostata aufklären. Erfahre Wissenswertes zum PSA-Wert, zur Wahrscheinlichkeit, an Prostatakrebs zu erkranken, zur Altersverteilung oder zu den Häufigkeiten in Deutschland.
Finde hier die Antworten auf all deine Fragen rund um das Thema Prostatakrebs-Vorsorge. Ergreife die Initiative, gehe so früh wie möglich in die Offensive und informiere dich hier über die Bedeutung und den Ablauf der Früherkennung – ganz nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“!
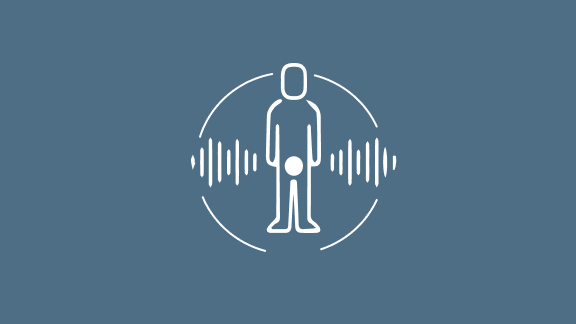
Der Podcast rund um Prostatakrebsfrüherkennung. Auch bei vermeintlich unangenehmen Themen nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Gleich reinhören!

Die Bestimmung des PSA-Wert ist ein wichtiger Teil der Vorsorge zur Früherkennung von Prostatakrebs. Wie eine Testung abläuft und ob sie das Richtige für Dich ist erfährst Du hier.

Die Prostata-Untersuchung zur Früherkennung hat Vorteile und aber auch mögliche Nachteile. Wie und woran man erkennen kann, welche Untersuchung notwendig ist, erfährst Du hier.
Die Prostata-Untersuchung: Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung
Zur Früherkennung von Prostatakrebs bietet dir die Prostata-Untersuchung Vorteile. Denn wenn ein Tumor zu einem Zeitpunkt erkannt wird, an dem er noch auf die Prostata begrenzt ist, ist er meist besser behandelbar, und die Heilungschancen sind höher. Einen möglichen Nachteil der Früherkennungsuntersuchung gibt es allerdings auch: Eine Prostata-Untersuchung kann keinen eindeutigen Befund hervorbringen, sodass weitere Kontrollen – rückblickend – bei dem ein oder anderen zu einer Überbehandlung führen, obwohl der Krebs keiner Behandlung bedurft hätte.
Wie und woran man Prostatakrebs erkennen kann und welche Untersuchungen notwendig sind, um eine Prostatakrebs-Diagnose zu stellen, erfährst du im Folgenden.
Was sind erste Anzeichen und Symptome im Frühstadium?
In der Regel entwickelt sich Prostatakrebs schleichend und ruft zu Beginn keine Symptome hervor. Allerdings lässt sich durch Vorsorgeuntersuchungen ein Prostatakarzinom auch in einem frühen Stadium entdecken. Der Vorteil dieser Früherkennung liegt darin, dass der Krebs häufig noch auf die Prostata beschränkt ist und somit eine größere Chance auf erfolgreiche Behandlung besteht. Ein potenzieller Nachteil dieser Untersuchungen ist jedoch, dass sie zu zusätzlichen Eingriffen und möglicherweise zu einer Übertherapie führen können. Die Entscheidung für eine Vorsorgeuntersuchung sollte daher in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin getroffen werden.
Erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Prostatakarzinoms treten in der Regel Symptome auf. Dies geschieht zum Beispiel, wenn der Tumor eine gewisse Größe erreicht und auf umliegendes Gewebe wie die Harnblase drückt oder sich der Krebs zu anderen Organen ausbreitet und Metastasen bildet.[1]
Zu den Anzeichen eines fortschreitenden Prostatakrebses zählen:
Häufiges Wasserlassen, besonders in der Nacht
Das Bedürfnis, nachts mehrmals aufzustehen, um zu urinieren, was den Schlafzyklus stören und auf eine überaktive Blase oder eine Prostataerkrankung hinweisen kann.Probleme beim Start des Wasserlassens, ein schwacher oder intermittierender Urinstrahl
Schwierigkeiten oder Verzögerungen beim Beginn des Urinierens, häufig verursacht durch eine Blockade oder Verengung der Harnröhre.Eine Unfähigkeit zur Blasenentleerung
Die vollständige Unfähigkeit zu urinieren ist ein Notfall, der eine sofortige medizinische Aufmerksamkeit erfordert und durch eine starke Blockade der Harnwege verursacht sein kann.
Blutspuren im Urin oder in der Samenflüssigkeit
Das Vorhandensein von Blut in diesen Flüssigkeiten kann ein Warnsignal für eine Reihe von Erkrankungen sein, darunter Infektionen, Entzündungen oder Krebs.Sexuelle Funktionsstörungen wie schmerzhafte Ejakulationen oder Schwierigkeiten bei der Erektion
Schmerzen während der Ejakulation oder Schwierigkeiten, eine Erektion zu erlangen oder zu halten, können auf Prostataerkrankungen oder neurologische Probleme hinweisen.Reduzierte Menge an Ejakulat
Eine verringerte Samenmenge bei der Ejakulation kann auf eine Blockade oder auf eine Dysfunktion der Samenleiter oder der Prostata hinweisen.Schmerzempfindungen in der Prostataregion
Beschwerden oder Schmerzen in der Prostata können durch Entzündungen, Infektionen oder Wachstum von Prostatagewebe ausgelöst werden.Intensive Schmerzen im unteren Rücken, dem Becken, den Hüften oder Oberschenkeln
Solche Schmerzen können von Metastasen herrühren, die auf die Knochen übergegriffen haben, aber auch von anderen, nicht krebsbedingten Erkrankungen wie Arthritis oder Ischias.Es ist wichtig zu betonen, dass diese Anzeichen nicht ausschließlich auf Prostatakrebs hinweisen, sondern auch bei anderen, gutartigen Prostataproblemen auftreten können, wie beispielsweise einer Prostatavergrößerung. Unabhängig davon ist es ratsam, bei Auftreten eines oder mehrerer dieser Symptome umgehend eine medizinische Untersuchung in Anspruch zu nehmen.
Der Ablauf der Prostata-Untersuchung
Prostata-Vorsorge: Hausärzt:innen oder Urolog:innen?
Vielleicht fragst du dich, welche Ärztin oder welchen Arzt du auf die Prostata-Untersuchung ansprechen sollst. Grundsätzlich kann deine Hausärztin oder dein Hausarzt erste:r Ansprechpartner:in sein. Allerdings wird die Untersuchung zur Früherkennung von Prostatakrebs ausschließlich bei Urolog:innen durchgeführt. Deine Hausärztin oder dein Hausarzt kann dein Erstkontakt sein, um dich zum Thema Vorsorge und Früherkennung zu informieren oder zu klären, ob bestimmte Symptome im Zusammenhang mit einer Veränderung deiner Prostata stehen können.
Prostata-Vorsorge: wann und wie oft?[2]
Prostatakrebs ist eine Erkrankung, die vor dem 50. Lebensjahr nur selten auftritt. Das Risiko für einen 35-jährigen Mann, in den nächsten 10 Jahren zu erkranken, liegt unter 0,1 %, das eines 75-jährigen Mannes hingegen bei etwa 6 %. Die relative 5-Jahres-Überlebensrate für Männer mit Prostatakrebs liegt bei 89 %. Etwa zwei Drittel der Tumore werden in einem frühen Stadium diagnostiziert. Generell gilt: Wird der Prostatakrebs in einem frühen Stadium erkannt, sind die Heilungschancen höher.
In Deutschland ist daher bei Männern mit einer verbleibenden Lebenserwartung von mehr als 10 Jahren die Vorsorgeuntersuchung auf Prostatakrebs ab 45 Jahren vorgesehen. Sie wird einmal jährlich empfohlen. Bei Männern mit erhöhtem Risiko für ein Prostatakarzinom kann diese Altersgrenze um 5 Jahre vorverlegt werden. Die rektale Tastuntersuchung wird ab diesem Alter von den gesetzlichen Krankenkassen in der Regel übernommen. Darüber hinaus kommt der sogenannte „PSA-Test“ in Betracht. Diese Untersuchung wird allerdings in der Regel von den Krankenkassen als sogenannte „IGeL-Leistung“ nicht erstattet.
Sollten bei dir Symptome auftreten, solltest du natürlich nicht warten, sondern frühzeitig mit deiner Ärztin oder deinem Arzt sprechen.
Wie läuft die Vorbereitungsuntersuchung ab?
Vor der eigentlichen Untersuchung der Prostata führt deine Ärztin oder dein Arzt mit dir ein ausführliches Gespräch über die Inhalte und Ziele der Früherkennungsuntersuchungen sowie über den Nutzen und die möglichen Nachteile. Sie oder er fragt nach eventuell bestehenden Beschwerden und möglichen Vorerkrankungen bei dir und in deiner Familie. Das ist wichtig, um deine Lebenserwartung einschätzen zu können.
Wie läuft eine Tastuntersuchung ab?
Zunächst werden Hoden und Penis sowie Lymphknoten und Haut in der Leiste abgetastet. Während dieser Voruntersuchungen liegst du bequem auf einer Liege. Für die eigentliche rektale Tastuntersuchung der Prostata wirst du dich dann in der Regel auf die Seite drehen. Wichtig ist, dass du dich in deiner Liegeposition entspannen kannst. Denn je entspannter du bist, desto unkomplizierter ist die Untersuchung.
Nun wird die Prostata rektal mit dem Finger abgetastet. Hierfür zieht sich die Urologin oder der Urologe einen Handschuh über und trägt etwas Gel auf, um den Finger leichter einführen zu können. Die Tastuntersuchung der Prostata dauert in der Regel nur Sekunden.
Was sagt der PSA-Test aus?
Ob eine Veränderung an der Prostata vorliegt, kann unter Umständen der sogenannte PSA-Test zeigen. Für diesen wird dir etwas Blut aus der Armvene abgenommen und das Prostata-spezifische Antigen (PSA) gemessen.[3] Dieses Protein wird von den Prostatadrüsen gebildet und kann bei Prostatakrebs erhöht vorliegen. Ein erhöhter Wert kann allerdings auch andere Ursachen haben wie beispielsweise eine Prostataentzündung oder gutartige Vergrößerung der Prostata.[4] Ist der PSA-Wert auffällig, wird er individuell überwacht.
Ergänzend zur Ermittlung des PSA-Werts können weitere Maßnahmen helfen, die Tumorausbreitung und das Erkrankungsstadium zu bestimmen: ein Tastbefund, Schnittbildgebung mittels MRT, eine feingewebliche Untersuchung, bildgebende Verfahren wie Ultraschall, CT, PSMA-PET/CT oder Knochenszintigraphie.
Anhand der erhobenen Befunde wird dann gemeinsam mit dir das weitere Vorgehen und die für dich geeignete Therapie geplant.
Unser Beitrag zum PSA-Wert erklärt, wie sinnvoll der PSA-Test ist und was du für den Blut-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs beachten musst.
Wie läuft eine Prostatabiopsie ab?
Falls im Rahmen der Früherkennung Hinweise auf einen Prostatakrebs bestehen, sollte eine Gewebeprobe (Biopsie) entnommen werden. Für die Biopsie der Prostata musst du nicht im Krankenhaus bleiben. Ein stationärer Aufenthalt ist nicht notwendig, denn die Prostatabiopsie wird in der Regel ambulant in der Klinik oder einer urologischen Arztpraxis durchgeführt.
Die Entnahme der Gewebeprobe dauert nur wenige Minuten und läuft wie folgt ab: Die Biopsie wird häufig unter einer lokalen Betäubung durchgeführt und erfolgt unter Kontrolle eines Ultraschallgerätes, das durch den Enddarm eingeführt wird. So stellt die Urologin oder der Urologe sicher, dass die Probe an der richtigen Stelle entnommen wird. Mit einer feinen Nadel werden mehrere kleine Gewebeproben der Prostata entnommen. Die Nadel für die Gewebeprobe wird durch den Mastdarm (Rektum) oder über den Damm eingeführt. Anschließend wird die Gewebeprobe mikroskopisch auf Krebszellen untersucht.
Findet die Pathologin oder der Pathologe in der Gewebeprobe Krebszellen, werden anhand dieser Probe zusätzliche Informationen über den Krebs wie das Stadium, die Ausbreitung und Aggressivität erhoben. Die Aggressivität des Prostatakrebses wird über den sogenannten Gleason-Score erfasst. Je höher der ermittelte Wert ist, desto aggressiver ist auch der Tumor.
In einigen Fällen kann die Prostatabiopsie auch in Kombination mit einer Magnetresonanztomographie (MRT) durchgeführt werden. Dann wird von einer Fusionsbiopsie gesprochen.
Die Prostatabiopsie birgt sehr selten Komplikationen, dazu gehören:
- ein kurzweiliges Druckgefühl
- Probleme beim Wasserlassen
- Kreislaufstörungen
- Blutbeimengung im Urin
- eine bakterielle Infektion
Auch wenn einzelne Komplikationen bei der Biopsie auftreten können, ist sie an sich ungefährlich. Sie hat weder Einfluss auf das Wachstum des Tumors noch begünstigt sie die Streuung von Krebszellen in deinem Körper.
Wann kommt eine Bildgebung mittels MRT in Frage?
Je nach PSA-Wert, digitalem Tastbefund und feingeweblicher Untersuchung können bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Schnittbildgebung mittels MRT (Magnetresonanztomographie), CT (Computertomographie), PSMA-PET/CT (Prostataspezifische Membranantigen-Positronenemissionstomographie /Computertomographie) oder Knochenszintigraphie helfen, die Erkrankung stadiengerecht einzuordnen. Erst danach kann die Therapie geplant und eine Heilung angestrebt werden.
Wie läuft das Prostata-MRT, -CT oder PSMA-PET/CT ab? Für diese Untersuchungen musst du nicht nüchtern sein, solltest aber bis zu 4 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr essen oder trinken. Da sexuelle Aktivität einen Einfluss auf die Interpretation der Bildgebung haben kann, solltest du bis 4 Tage vor einer geplanten Untersuchung enthaltsam sein. Zur direkten Vorbereitung des MRTs sollte, wenn möglich, Blase und Darm entleert werden. Da die Darmaktivität die Bilddarstellung im MRT stören kann, können ebenfalls zur Vorbereitung auf die Untersuchung bestimmte Medikamente verabreicht werden, die die Aktivität des Darms kurzzeitig unterdrücken. Zudem wird ein Kontrastmittel über die Vene appliziert.
Während des MRTs, das ungefähr 30 Minuten dauert, liegst du entspannt auf dem Rücken. Du wirst mit den Füßen voran in die MRT-Röhre geschoben, wobei der Kopf in der Regel außerhalb bleibt. Die Schichtaufnahme des Körpers erfolgt beim MRT mit Hilfe von Magnetfeldern.
Das CT läuft ähnlich ab und dauert wenige Minuten. Beim CT werden Röntgenstrahlen verwendet, um Bilder des Körpers aufzunehmen. Beim PSMA-PET/CT wird das CT mit dem Bildgebungsverfahren PET kombiniert. Die PET ist in der Lage, das radiologisch markierte PSMA im Körper sichtbar zu machen. Mit Hilfe des CTs können diese Signale dann räumlich zugeordnet werden, um die genaue Lage des Tumor zu ermitteln. Die gesamte Bildgebung dauert insgesamt etwa eineinhalb bis zwei Stunden.[5]
Welche Vorteile hat eine Fusionsbiopsie?
Die Fusionsbiopsie der Prostata ist eine Kombination von Bildern gewonnen aus dem MRT (Magnetresonanztomographie) und dem Bild aus dem Echtzeit–Ultraschall. Durch den Zusammenschluss kann die Gewebeentnahme bei der Prostata-Biopsie gezielter und sicherer durchgeführt werden, da der Tumor besser lokalisiert werden kann. So kann gewährleistet werden, dass die Biopsie der Prostata auch direkt im Tumorgewebe erfolgt. Ein weiterer Vorteil der Fusionstherapie ist die Option der Probenentnahme über die Dammregion, was ein geringeres Infektionsrisiko mit sich bringt als der Zugang über den Enddarm.
Kostet mich die Prostata-Untersuchung etwas?[6]
Bei Männern ab 45 Jahren zahlt die gesetzliche Krankenkasse einmal im Jahr eine Tastuntersuchung der Prostata. Solange kein Verdacht auf ein Prostatakarzinom besteht, sind alle anderen Untersuchungen selbst zu zahlen – das bedeutet: Sie sind kein Teil der Vorsorgeuntersuchung! Sobald der Verdacht jedoch durch einen positiven Tastbefund oder Symptome besteht, werden die Untersuchungen von der Kasse übernommen.
Besteht kein Verdacht auf Prostatakrebs, ist der PSA-Test eine Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) und wird somit nicht von der Kasse übernommen – Kostenpunkt liegt bei ca. 25 Euro, hinzu kommen etwa weitere 20 Euro, um das Ergebnis mit dem Arzt oder der Ärztin zu besprechen.
Auch der transrektale Ultraschall (TRUS) zur Früherkennung von Prostatakrebs ist keine Kassenleistung. Der TRUS kostet ungefähr 20 bis 60 Euro[7].
Das MRT und die Fusionsbiopsie sind technisch aufwendige Verfahren, die je nach Klinik zu unterschiedlichen Kosten führen können. Falls eine solche Untersuchung gewünscht ist, besprich es mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Es hilft dir zu entscheiden, ob die Untersuchung einen Mehrwert für dich bringt.
Prostatakrebs vorbeugen, Risiko senken[8]
Keine Maßnahme kann der Entstehung von Prostatakrebs vorbeugen. Trotzdem kann ein gesunder Lebensstil das Risiko für eine Krebserkrankung generell senken.
- Gesunde/kalorienarme Ernährung Grundsätzlich ist eine ausgewogene Ernährung empfehlenswert. Hilfreich ist es zum Beispiel auf Zucker, gesättigte Fettsäuren, Transfette und Alkohol zu verzichten. Frittierte, gebratene und süße Speisen solltest du seltener zu dir nehmen und dafür auf eine ausgewogene Zufuhr von Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen achten.
- Rauchen Wurde bei dir Prostatakrebs diagnostiziert, ist es empfehlenswert, mit dem Rauchen aufhören. Denn Studien haben gezeigt, dass Rauchen das Sterberisiko bei Prostatakrebs zusätzlich erhöhen kann.[9]
- Körperliche Aktivität Regelmäßiger Sport stärkt die körperliche Fitness und hilft, ein gesundes Körpergewicht zu halten. Jede Aktivität zwischen 30 und 60 Minuten am Tag, kann sich positiv auf die körperliche Fitness auswirken. Dazu gehören lockeres Fahrradfahren oder schnelles Gehen sowie Schwimmen oder Aerobic. Wenn du zu Übergewicht tendierst, versuche das Gewicht durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung und sportliche Aktivität zu reduzieren. Wenn du Hilfe brauchst, sprich mit deinem Arzt oder deiner Ärztin über mögliche Optionen.
- Gesunde Sexualität[10] Es gibt Hinweise dazu, dass Männer, die häufiger ejakulieren, ein geringeres Risiko für die Entwicklung eines Prostatakarzinoms aufweisen.
Wichtig: Eine Früherkennung ist keine Vorsorge! Auch wenn die Untersuchung oft als „Krebsvorsorge“ bezeichnet wird, verhindert sie nicht die Entstehung von Krebs. Vielmehr geht es darum, den Krebs frühzeitig zu erkennen, um ihn schnellstmöglich zu behandeln.
Häufige Fragen zur Vorsorge und Früherkennung von Prostatakrebs
Wie wird die Prostatakrebsfrüherkennung durchgeführt?
Die Prostatakrebsfrüherkennung umfasst ein Vorgespräch und verschiedene Untersuchungen. Zunächst werden in einem Ärzt:innen-Patient-Gespräch mögliche Beschwerden und Vorerkrankungen der Familie erfasst. Das ist wichtig, um mögliche Risikofaktoren zu identifizieren. Folgende Untersuchungen können Teil der Prostatakrebsfrüherkennung sein:
- PSA-Test
- Körperliche Untersuchung
- Bildgebung
- Biopsie (bei Auffälligkeiten)
Wie läuft die körperliche Untersuchung ab?
Zunächst werden Hoden und Penis sowie Lymphknoten und Haut in der Leiste im Liegen abgetastet. Danach wird die Prostata rektal mit dem Finger abgetastet. Die Tastuntersuchung dauert für gewöhnlich nur wenige Sekunden. Versuche dich bei der rektalen Untersuchung möglichst zu entspannen – je entspannter du bist, desto einfacher ist die Untersuchung.
Hilft ein PSA-Test bei der Früherkennung von Prostatakrebs?
Die Kombination von PSA-Test und rektaler Untersuchung verbessert die Früherkennungsrate für Prostatakrebs gegenüber der alleinigen rektalen Untersuchung. Dein persönliches Risiko für einen Prostatakrebs kann besser abgeschätzt werden. So lassen sich gegebenenfalls weitere Untersuchungen zur Klärung anstoßen, wie z.B. eine Bildgebung mittels Ultraschall, MRT (Magnetresonanztomographie) oder aber die Entnahme einer Gewebeprobe der Prostata. Gleichzeitig entdeckt man dadurch aber auch häufig Krebs, der ohne Test nie aufgefallen aber nie gefährlich geworden wäre.[11] Das kann zu unnötigen Behandlungen führen.
Wie läuft der PSA-Test ab?
Für den PSA-Test wird dir etwas Blut abgenommen und das Prostata-spezifische Antigen (PSA) bestimmt.[3] Ein erhöhter Wert dieses Proteins kann auf Prostatakrebs hindeuten, allerdings können auch andere Ursachen zugrunde liegen. Kosten für den PSA-Test tragen die Patienten selbst.[3]
Unser Artikel zum PSA-Wert erklärt, wie sinnvoll der PSA-Test ist und was du für den Blut-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs beachten muss.
Wie läuft eine Gewebeprobe (Biopsie) ab?
Falls im Rahmen der Früherkennung ein Verdacht auf eine bösartige Erkrankung der Prostata besteht, sollte eine Biopsie durchgeführt werden.[12] Bei einer Biopsie werden mit einer feinen Nadel mehrere kleine Gewebeproben der Prostata entnommen. Werden Krebszellen gefunden, kann die Pathologin oder der Pathologe über die Bestimmung des sogenannten Gleason-Scores auf die Tumoraggressivität schließen.[12]
Musst du bei einer Biopsie im Krankenhaus bleiben?
Die Prostatabiopsie wird meist ambulant in der Klinik oder einer urologischen Arztpraxis durchgeführt – ein stationärer Aufenthalt ist also nicht notwendig.
Kann der Prostatakrebs durch eine Biopsie verstreut werden?
Bis heute gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Biopsie die Prognose durch Streuung der Tumorzellen verschlechtert.
Welche bildgebenden Verfahren gibt es?
Ergänzend zu den genannten Untersuchungen können bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Schnittbildgebung mittels MRT (Magnetresonanztomographie) oder CT (Computertomographie) und Knochenszintigraphie helfen, die Tumorausbreitung und das Erkrankungsstadium zu bestimmen. Anhand der erhobenen Befunde wird dann mit dir gemeinsam das weitere Vorgehen und eine Therapie für dich geplant.
Zu welcher Ärztin oder welchem Arzt gehst du für die Prostata-Untersuchung?
Die Prostata-Untersuchung zur Früherkennung von Prostatakrebs wird ausschließlich bei Urolog:innen durchgeführt. Trotzdem können auch Hausärzt:innen dein Erstkontakt sein, wenn du dich zum Thema Vorsorge und Früherkennung informieren möchtest.
Symptome bei Prostatakrebs: Wann solltest du zu Ärzt:innen gehen?
In den Anfangsstadien eines Prostatakarzinoms treten meist keine Beschwerden auf. Erst bei fortgeschrittener Erkrankung kann es zu Schmerzen im Becken- und Rückenbereich sowie zur Beeinträchtigung der Blasen- oder Darm-Funktion kommen. Sobald Beschwerden auftreten, solltest du immer einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, um die Ursache zu identifizieren. Ab einem Alter von 45 Jahren empfiehlt sich die Prostatakrebsfrüherkennung, um einen möglichen Tumor zu entdecken und entsprechend zu behandeln, bevor Symptome auftreten.
Kann Krebs durch Ernährung & Sport verhindert werden?
Durch Studien konnte nicht belegt werden, dass Sport oder Ernährung vor einer Prostatakrebserkankung schützen. Aufgrund von Beobachtungsdaten empfehlen Expert:innen allgemein: körperliche Aktivität, gesundes Gewicht, geringer Alkoholkonsum und kein Rauchen.[13]
Prostatakrebs: Wie hoch ist dein Risiko?
Prostatakrebs ist eine Krebsart, die mehr Menschen betrifft, als man vielleicht denkt: Mit 65.200 Neuerkrankungen pro Jahr ist Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland.[14] Sich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und die wichtigsten Fakten zu kennen, ist daher wichtig, denn das Risiko eines einzelnen Mannes, an Prostatakrebs zu erkranken, beträgt etwa rund 12%. Das bedeutet, dass jeder achte Mann in seinem Leben an Prostatakrebs erkrankt.[14]
Mögliche Risikofaktoren können das Risiko für Prostatakrebs erhöhen:[14]
- Alter
- Prostatakrebsvorerkrankungen in der Familie
- Chronische Erkrankungen der Prostata
- Sexuell übertragbare Erkrankungen
Generell können Störungen des Hormonhaushalts mit Erhöhung der Androgene, vor allem das männliche Geschlechtshormon Testosteron betreffend, zwar kein Prostatakrebs auflösen, jedoch können sie die Entwicklung eines bereits bestehenden Prostatakarzinoms beschleunigen.
Was ist das Ziel der Prostatakrebsfrüherkennung?
Die Früherkennungsuntersuchung ist wichtig, um Prostatakrebs rechtzeitig zu identifizieren. Ziel ist es, den Tumor zu einem Zeitpunkt zu erfassen, an dem er noch auf die Prostata begrenzt ist. Denn so ist er meist besser behandelbar und die Heilungschancen sind höher.
Welche Nachteile hat die Früherkennung von Prostatakrebs?
Durch die Früherkennung kann Krebs entdeckt werden, der nie gefährlich geworden wäre. In der Folge kann zu einer Überbehandlung kommen.
Welche Vorteile hat eine Fusionsbiopsie?
Vorteil der sogenannten Fusionsbiopsie sind eine genauere Lokalisierung des Tumors im Gewebe, was die Biopsie sowohl gezielter als auch sicherer macht.
Ab wann und wie oft solltest du zur Prostatakrebs-Vorsorge gehen?
Die Prostata-Vorsorge zur Früherkennung von Prostatakrebs wird ab einem Alter von 45 Jahren einmal jährlich empfohlen. Sollten Symptome auftreten, solltest du natürlich jederzeit mit deiner Ärztin oder deinem Arzt sprechen.
Unser Expertenrat

Haben Sie Fragen zur Erkrankung, die nach dem Gespräch mit Ihrem Arzt unbeantwortet geblieben sind und auch hier nicht geklärt werden konnten? Unser Expertenrat beantwortet Ihnen online und diskret Ihre Fragen rund um Prostatakrebs.

Deine Manndeckung möchte helfen, das Tabu zu brechen und thematisiert die potentiellen Ängste und Hemmungen der Männer rund um das Thema Prostatakrebs-Vorsorge in dem neuen Podcast der Initiative.
Prostatakrebs ist eine Krebsart, die mehr Menschen betrifft, als man denkt: Mit 65.200 Neuerkrankungen pro Jahr ist Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Sich mit dem Gegner auseinanderzusetzen und die wichtigsten Fakten zu kennen, ist daher wichtig, denn das Risiko eines einzelnen Mannes, an Prostatakrebs zu erkranken, beträgt etwa 12%. Das bedeutet, dass jeder achte Mann in seinem Leben an Prostatakrebs erkrankt.
Dieser Text entspricht den redaktionellen Standards der JanssenWithMe und wurde von einem Mitglied des redaktionellen Beirats der JanssenWithMe geprüft. Lernen Sie hier den medizinischen Beirat unserer Redaktion kennen.
EM-150081
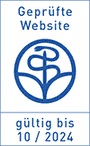
Das Gütesiegel bestätigt die gutachterliche Prüfung der Website im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens der Stiftung Gesundheit. Es stellt sicher, dass Gesundheitsinformationen in qualifizierter Weise zur Verfügung stehen und somit die Transparenz für Patient:innen fördert.
EM-142857
Referenzen
