Patientenrechte & Sozialleistungen

Patientenrechte & Sozialleistungen
Übersicht über Sozialleistungen für Krebspatienten
Für den Bedarfsfall informiert
Bei einer Krebserkrankung kommen nicht nur Fragen zur Behandlung und den Therapien auf. Auch Fragen zur Erstattung der Behandlungskosten, zur wirtschaftlichen Absicherung, zur Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags oder zu Rehabilitationsmöglichkeiten werden auf einmal wichtig. Doch welche Ansprüche hat man als Krebspatient eigentlich und an welche Institutionen muss man sich wenden, um Sozialleistungen zu beantragen?
Eine Krebserkrankung zieht sowohl nach der Erstdiagnose und der ersten Behandlung als auch während eines Rückfalls Veränderungen nach sich. Deshalb gibt es für Krebspatienten besondere Unterstützungsangebote. Diese sind allerdings breit gestreut und nicht immer leicht zu durchschauen. Auch ist oft nicht klar, welche Ansprüche man als Patient oder Angehöriger überhaupt hat.
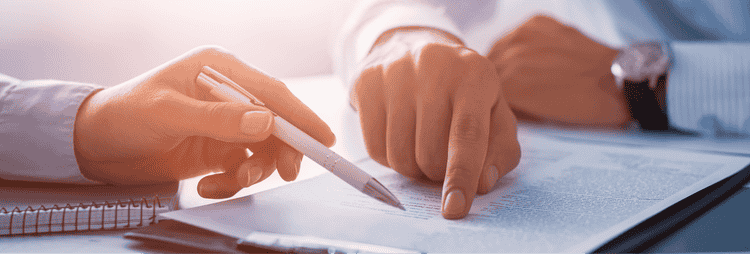
Wer informiert vor Ort?
Bei den in Kliniken ansässigen Sozialdiensten erhalten Sie Auskunft über Ihre Ansprüche, bekommen Unterstützung bei der Antragstellung und können an die passenden Behörden verwiesen werden.
Manche onkologischen Praxen bieten eine ähnliche Unterstützung an. Eine weitere Anlaufstelle im nicht-stationären Bereich sind Krebsberatungsstellen, die Sie zu den unterschiedlichsten sozialrechtlichen Fragen beraten können.
Welche Leistungen erbringen Krankenkassen?
Die gesetzlichen Krankenkassen sind für die meisten medizinischen Leistungen der passende Ansprechpartner. Folgende Kosten im Zusammenhang mit einer Krankenbehandlung übernehmen in der Regel die Krankenkassen:
- ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie
- Krankenhausbehandlung
- Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln
- häusliche Krankenpflege, soweit eine im Haushalt des Versicherten lebende Person den Kranken nicht im erforderlichen Umfang pflegen und versorgen kann. Es können weitere Einschränkungen bestehen, die davon abhängen, aus welchem Grund die häusliche Krankenpflege in Anspruch genommen wird. Der Grund für die häusliche Krankenpflege ist auch ausschlaggebend dafür, welche Art der Pflege (Grund- oder Behandlungspflege) erfasst ist und ob zusätzlich die häusliche Versorgung mit umfasst wird.
- Haushaltshilfe, wenn die Weiterführung des Haushalts wegen einer Krankenhausbehandlung (u.a.) nicht möglich ist, eine im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann und im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Darüber hinaus erhalten Versicherte, soweit keine Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 im Sinne des SGB XI vorliegt Haushaltshilfe für die Dauer von höchstens vier Wochen, wenn ihnen die Weiterführung des Haushalts wegen schwerer Krankheit oder akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung, nicht möglich ist nicht möglich ist. Wenn im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist, verlängert sich der Anspruch auf maximal 26 Wochen. Haushaltshilfe zur Versorgung des Kindes wird auch bei Pflegebedürftigkeit des Versicherten (s.o.) gewährt. Die Satzung der Krankenkasse kann Haushaltshilfe für weitere Fälle vorsehen. Kann die Krankenkasse keine Haushaltshilfe stellen oder besteht Grund, davon abzusehen, sind dem Versicherten die Kosten für eine selbstbeschaffte Kraft in angemessener Höhe zu erstatten. Für Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad bestehen Einschränkungen.
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen
- Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
- stationäre und ambulante Hospizleistungen
- Übernahme von Kosten für Fahrten, wenn sie im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse aus zwingenden medizinischen Gründen notwendig sind
- Krankengeld (v. a. für arbeitsunfähige, abhängig erwerbstätige Versicherte mit Ansprüchen auf Entgeltfortzahlung für mindestens sechs Wochen, sobald sie kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt mehr erhalten)
Wenn ein Krankenhausaufenthalt geboten, aber nicht ausführbar ist, oder wenn er dadurch vermieden oder verkürzt wird, verordnet der Arzt häusliche Krankenpflege. Die häusliche Krankenpflege umfasst in diesem Fall die im Einzelfall erforderliche Grund- und Behandlungspflege (beispielsweise die Wundversorgung), sowie eine hauswirtschaftliche Versorgung. Kann die Krankenkasse keine Kraft für die häusliche Krankenpflege stellen oder besteht Grund, davon abzusehen, sind dem Versicherten die Kosten für eine selbstbeschaffte Kraft in angemessener Höhe zu erstatten. Voraussetzung ist, dass diese Aufgaben keine im Haushalt lebende Person übernehmen kann.
Auch die Fahrtkosten zu ambulanten Behandlungen, wie einer onkologischen Chemo- und Strahlentherapie, können von der Krankenkasse in besonderen Ausnahmefällen übernommen werden, die der Gemeinsame Bundesausschuss in der Krankentransport-Richtlinie festgelegt hat. Die Übernahme der Kosten erfolgt nur nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse und unter Abzug der gesetzlichen Zuzahlungen nach § 61 SGB V. Anerkannt werden in der Regel die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel unter Ausschöpfung von Fahrpreisermäßigungen oder ein gesetzlich bestimmter Anteil der Kosten für die Benutzung eines Taxis oder Mietwagens, wenn weder ein öffentliches Verkehrsmittel noch ein privates Kraftfahrzeug benutzt werden kann. Einzelheiten sind in Richtlinien, Rahmenempfehlungen oder Verträgen zwischen Krankenkassen und geeigneten Leistungserbringern geregelt. Sprechen Sie über die genauen Voraussetzungen und Zuzahlungen zu den jeweiligen Leistungen mit Ihrer Krankenkasse.
Was übernimmt die Pflegeversicherung?
Sobald eine Pflegebedürftigkeit im Sinne des 11. Sozialgesetzbuchs (SGB XI), z. B. durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, festgestellt wurde und Sie entweder zu Hause oder stationär gepflegt werden, übernimmt auf Antrag Ihre Pflegeversicherung die Kosten. Folgende Leistungen werden dann in verschiedenem Umfang je nach zugeordnetem Pflegegrad von der Pflegekasse übernommen:
- Pflegesachleistung (häusliche Pflegehilfe)
- häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
- Pflegegeld für selbstbeschaffte Pflegehilfen
- Pflegehilfsmittel und Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen
- Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen
- Kurzzeitpflege (bis zu vier Wochen pro Jahr)
- vollstationäre Pflege
Um den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, haben Prävention, Krankenbehandlung und medizinische Rehabilitation immer Vorrang.
Wer übernimmt die Kosten für die Rehabilitation?
Auch eine onkologische Rehabilitation (ambulant oder stationär) kann für Sie in Betracht kommen. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden von der gesetzlichen Krankenkasse bzw. für Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen vom Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB IX) übernommen. Für die berufliche Rehabilitation und für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.
Beamte und Selbstständige müssen sich hingegen an ihre private Krankenversicherung wenden. Die Suche nach passenden Beratungsstellen zum Thema Rehabilitation vor Ort erleichtert die Seite REHA-Servicestellen.
Wie sieht die finanzielle Unterstützung für Krebspatienten aus?
Angestellte Berufstätige können bei Verdienstausfällen Leistungen von der Krankenkasse in Form von Krankengeld erhalten, sobald und soweit der 6-Wochen-Zeitraum der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall abgelaufen ist (s.o.). Je nach Krankheits- und Behandlungsverlauf kann eine Erwerbsminderungsrente von der gesetzlichen Rentenversicherung in Betracht kommen. Privat Versicherte müssen Verdienstausfälle über eine entsprechende Krankentagegeldversicherung abfangen. Wenn Sie sich zum Zeitpunkt der Erkrankung in keinem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis befunden haben, können Sie finanzielle Hilfen auch über die Arbeitsagentur oder die Sozialämter beziehen.
Bei vielen medizinischen Leistungen müssen gesetzlich versicherte Patienten eine Zuzahlung bis zu einer gesetzlich definierten Belastungsgrenze leisten. Diese Belastungsgrenze beträgt zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt (weitere Details regelt § 62 SGB V). Bei langen Krankenhausaufenthalten, vielen Medikamenten und weiteren unterstützenden Leistungen (z. B. Fahrtkosten) kann für Krebspatienten eine größere Summe zusammenkommen. Für chronisch Kranke, die wegen derselben schwerwiegenden Krankheit in Dauerbehandlung sind, reduziert sich die maximale Zuzahlung in Höhe von zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen auf ein Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Für nach dem 1. April 1972 geborene chronisch Kranke, die ab dem 1. Januar 2008 gesetzlich vorgesehene Gesundheitsuntersuchungen vor der Erkrankung nicht regelmäßig in Anspruch genommen haben, gilt die Ermäßigung allerdings nicht. Ist die Belastungsgrenze erreicht, kann man sich durch die Krankenkasse für den Rest des Kalenderjahres von der gesetzlichen Zuzahlung befreien lassen. Eine schwerwiegende chronische Erkrankung ist gegeben, wenn diese mindestens seit einem Jahr einmal pro Quartal ärztlich behandelt wurde und Pflegebedürftigkeit, eine Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 60 Prozent oder aber ein Behinderungsgrad oder ein Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 60 vorliegt. Gleiches gilt, wenn eine kontinuierliche medizinische Versorgung (ärztliche oder psycho-therapeutische Behandlung, Arzneimitteltherapie, Behandlungspflege, Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln) erforderlich ist, weil sonst nach ärztlicher Einschätzung eine lebensbedrohliche Verschlimmerung, eine Verminderung der Lebenserwartung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität zu erwarten ist. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer Krankenkasse.
In besonderen Notlagen stehen Krebspatienten auch finanzielle Hilfen durch Stiftungen, Verbände und karikative Einrichtung zur Verfügung. Der Härtefond der Deutschen Krebshilfe zum Beispiel bietet Krebspatienten einen einmaligen, an Einkommens- und Vermögensgrenzen gebundenen Zuschuss, wenn sie in eine finanzielle Notsituation geraten sind. Das Antragsformular finden Sie hier.
Weiterführende Informationen
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
Rechtzeitig vorgesorgt: Den eigenen Behandlungswillen verbindlich festlegen
Es ist für viele Patienten enorm wichtig, autonom zu bleiben und maßgebliche persönliche Entscheidungen bis zum Schluss selbst fällen zu können. Es stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um seinem Willen und seinem Selbstbestimmungsrecht für den Fall Ausdruck zu verleihen, dass man selbst nicht mehr entscheiden kann.

Bereits im Voraus sollte sich jeder – auch gesunde Menschen – für den Ernstfall mit folgenden Fragen befassen: Wie und bis wann möchte ich medizinisch behandelt werden (z. B. Beatmung, künstliche Ernährung, Wiederbelebungsmaßnahmen)? Wer soll die Befugnis für medizinische Entscheidungen erhalten, wenn ich diese Entscheidungen nicht mehr treffen kann und vorab nicht treffen will? Wie sehen meine ethischen oder religiösen Überzeugungen und meine persönlichen Wertvorstellungen in Bezug auf Leben und Sterben aus und wie sollen diese umgesetzt werden?
Die rechtlichen Instrumentarien Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung treffen Vorkehrungen, die Ihnen auch bei aktueller Handlungsunfähigkeit eine Stimme geben. Angehörige erhalten mehr Sicherheit im Umgang mit dem Erkrankten und sehen sich seltener mit der Situation konfrontiert, beim Wunsch, den (mutmaßlichen) Willen des Erkrankten umzusetzen, an rechtliche Grenzen zu stoßen. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um Ihre persönlichen Wünsche in diesen Verfügungen und Vollmachten festzulegen und schriftlich zu fixieren. Binden Sie die jeweilige Person, die Sie bevollmächtigen, dabei ein.
Im Detail geht es bei den genannten Instrumentarien um Folgendes:
- Patientenverfügung: Ein einwilligungsfähiger Volljähriger kann für den Fall seiner eventuell später eintretenden Einwilligungsunfähigkeit im Vorhinein schriftlich festlegen, ob er in bestimmte Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt.
- Betreuungsverfügung: Er kann zudem f�ür den Fall seiner späteren rechtlichen Betreuung Vorschläge zur Auswahl der Person eines rechtlichen Betreuers machen, die das Betreuungsgericht dann zu berücksichtigen hat.
- Vorsorgevollmacht: Er kann weiterhin eine Person seines Vertrauens bevollmächtigen, im Falle seiner eigenen Einwilligungsunfähigkeit mit Wirkung für ihn in Untersuchungen seines Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Heileingriff einzuwilligen oder aber diese zu untersagen.
Selbst wenn eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff bzw. deren jeweiliges Unterlassen die Gefahr begründet, dass der Patient stirbt oder einen länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, ist eine Genehmigung dieser Maßnahmen durch ein Betreuungsgericht entbehrlich, wenn im Falle einer Patientenverfügung zwischen behandelndem Arzt und Betreuer bzw. Bevollmächtigtem Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem in der Patientenverfügung dokumentierten Willen des Patienten entspricht (§ 1829 Abs. 4 BGB).
Denken Sie zudem daran, zum Beispiel Passwörter und Bankunterlagen so zu hinterlegen, dass die ausgewählte Vertrauensperson, etwa im Falle eines langen Krankenhausaufenthalts, problemlos an die Daten gelangt und die wichtigsten Dinge schnell und einfach klären kann. Lassen Sie sich zudem zu Bankvollmachten von Ihrer Bank beraten. Solche Vollmachten können grundsätzlich bereits zu Lebzeiten gelten, aber auch ausdrücklich erst mit dem Todesfall wirksam werden. Wie Sie Ihren Nachlass regeln möchten, können Sie in einem Testament festhalten. Machen Sie sich frühzeitig mit den Anforderungen an ein gültiges Testament vertraut.
Wichtig ist, dass alle Dokumente im Bedarfsfall schnell auffindbar sind und dass keine Zweifel an ihrer Gültigkeit bestehen. Dazu sollten Sie eine Vertrauensperson, ggf. dieselbe, die von Ihnen bevollmächtigt oder als Betreuer vorgeschlagen wurde, über den Aufbewahrungsort der Unterlagen informieren. Die Dokumente können auch beim zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer hinterlegt und die Erklärungen regelmäßig durch Anfügung des aktuellen Datums und einer Unterschrift aktualisiert werden.
Weitere hilfreiche Informationen und Materialien
- Ausführliche Informationen und Textbausteine für Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht erhalten Sie kostenfrei unter www.patientenverfuegung.de und beim beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.
- Einen guten Überblick sowie Formulare bietet die Broschüre „Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter“, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Die Broschüre erhalten Sie hier kostenfrei als PDF.
- Beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer können gebührenpflichtig Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung registriert werden.
Recht auf Selbstbestimmung
Wann behandeln, wie behandeln? Ihr Recht auf Selbstbestimmung
Häufig sind Patienten und ihren Angehörigen die Möglichkeiten der Mitsprache und Selbstbestimmung bei der Krebstherapie nicht bekannt. Tatsächlich haben sie aber umfangreiche Möglichkeiten, bei der Behandlung mitzuentscheiden.
Mittlerweile wurde auch im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 630a ff.) verankert, dass jeder Patient in medizinische Behandlungen einwilligen muss, damit diese in rechtlich zulässiger Weise durchgeführt werden können. Die wesentlichen Rechte von Patienten und die Pflichten der behandelnden Ärzte und Kliniken sind nachfolgend zusammengefasst.
Die Einwilligung des Patienten ist unabdingbar
Der Patient hat das uneingeschränkte Recht auf Selbstbestimmung. Daher ist seine freie Einwilligung eine unabdingbare Voraussetzung für jeden medizinischen Eingriff. Vor der Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere bei einem Eingriff in den Körper oder die Gesundheit, muss der Behandelnde die Einwilligung des Patienten einholen. Fehlt es an einer wirksamen Einwilligung und durfte auf diese auch nicht verzichtet werden, handelt es sich bei der medizinischen Behandlung um eine rechtswidrige Körperverletzung.
Auf eine Einwilligung darf nur in engen Ausnahmefällen verzichtet werden. Das gilt nur dann, wenn sie aufgrund einer unaufschiebbaren Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt werden kann und die Maßnahme dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht. Anhaltspunkte, ob sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht, können vorherige Äußerungen des Patienten über bestimmte Behandlungen geben. Deshalb können Familienangehörige und Vertrauenspersonen einen wichtigen Beitrag leisten, um den Willen des Patienten herauszufinden.
Damit seine Einwilligung wirksam ist, muss der Patient aber zuvor ordnungsgemäß von dem Arzt aufgeklärt werden.
Einwilligung setzt Aufklärung voraus – ohne Aufklärung keine Einwilligung!
Der behandelnde Arzt ist verpflichtet, den Patienten über alle für die Entscheidung des Patienten relevanten Umstände aufzuklären, damit der Patient eine informierte Einwilligung erteilen kann. Die Aufklärung dient also dazu, dem Patienten die selbstbestimmte Entscheidung zu ermöglichen, ob er den vorgeschlagenen Eingriff vornehmen lassen möchte oder eine andere Therapie wünscht oder ob er mitunter sogar auf eine Behandlung verzichtet.
Worüber aufgeklärt werden muss, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Der Arzt muss den Patienten grundsätzlich über alle Faktoren aufklären, die dem Patienten eine Abwägung der Aspekte „Für und Wider“ die Behandlung ermöglichen. Dazu gehören unter anderem Umstände wie die Notwendigkeit und Erfolgsaussichten der Behandlung, ihre Art und genaue Durchführung sowie ihre Risiken. Der Arzt muss den Patienten auch über verfügbare alternative Behandlungsmöglichkeiten aufklären. Die Aufklärung muss für den Patienten verständlich sein. Zur Wahrung ihrer Selbstbestimmung dürfen und sollten Patienten ihren Arzt bei Unklarheiten oder offenen Fragen um ergänzende Informationen bitten.
Hat der Patient in die Durchführung der Behandlung eingewilligt, muss der Behandelnde über alle für die Behandlung wesentlichen Aspekte und alle während der Behandlung zu beachtenden Umstände informieren, um den Behandlungserfolg zu sichern (u.a. Aufklärung über die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung unter der Therapie und die bei oder nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen).
Die Aufklärung darf nur in engen Ausnahmefällen entfallen. Der Arzt darf auf die Aufklärung des Patienten verzichten, wenn diese ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist. Solche besonderen Umstände liegen etwa dann vor, wenn die Maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient auf die Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat.
Patientenverfügung sichert Beachtung des Patientenwillens
Ist der Patient nicht einwilligungsfähig, kann eine Patientenverfügung weiterhelfen. Diese ist für die Behandelnden bindend. In einer Patientenverfügung können Sie – für den Fall, dass Sie eines Tages Ihren Willen nicht mehr selbst artikulieren können – verbindlich festlegen, welche medizinischen Maßnahmen Sie wünschen und welche nicht. Sie können darin auch festlegen, wer in medizinischen Angelegenheiten dafür sorgen soll, dass ihr Wille umgesetzt wird.
Die Anforderungen an eine Patientenverfügung sind mittlerweile im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt (§ 1901a). Mit einer Patientenverfügung können Sie daher Vorsorge treffen, damit Ihr Wille im Falle des Falles auch beachtet wird.
Das Recht auf eine zweite fachliche Meinung
Unter einer ärztlichen Zweitmeinung versteht man die zweite Bewertung einer ärztlichen Diagnose oder eines Therapievorschlags durch einen unabhängigen und an der Behandlung des Patienten nicht beteiligten Arzt. Eine zweite Meinung kann Ihnen helfen, Unsicherheiten zu überwinden und sich einen besseren Überblick über Therapiealternativen zu verschaffen. Sie kann beispielsweise sehr wichtig für die Beurteilung der Risiken und Chancen eines operativen Eingriffs sein.
Medizinische Fragen wie etwa die Vor- und Nachteile verschiedener Behandlungsverfahren sind nicht immer einfach zu beurteilen. Daher kann die Einholung einer zweiten Meinung auch helfen, eine Entscheidung zwischen unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten zu treffen.
Unter bestimmten Umständen haben Patienten einen Anspruch auf die Einholung einer unabhängigen ärztlichen Zweitmeinung. Die Voraussetzungen dieser Zweitmeinung sind für gesetzlich Krankenversicherte in § 27b SGB V und in einer Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren näher geregelt. Allgemein gesagt, besteht der Anspruch bei bestimmten „planbaren Eingriffen“. Darüber hinaus können Krankenkassen in ihren Satzungen zusätzliche Leistungen zur Einholung einer unabhängigen ärztlichen Zweitmeinung vorsehen.
Klären Sie deshalb vorab, ob Ihre Krankenkasse die Kosten für eine Zweitmeinung übernimmt und welche Bedingungen dafür gelten. Hiervon unbenommen bleibt Ihr Recht als Patient, eine zweite ärztliche Einschätzung einzuholen und die Kosten selbst zu tragen.
Die Teilnahme an klinischen Studien – Chance oder Risiko?
In klinischen Studien werden Arzneimittel und Behandlungsverfahren an einer größeren Zahl Patienten in ausgewählten Einrichtungen getestet. Der Ablauf der Behandlung folgt dabei einem vorab festgelegten und genehmigten Prüfplan. Die Teilnahmemöglichkeit ist an bestimmte Ein- und Ausschlusskriterien geknüpft, die der zuständige Prüfarzt kennt und deren Vorliegen er bei Ihnen überprüfen kann.
Auch die Teilnahme an einer klinischen Studie erfordert stets die vorherige Einwilligung des Patienten. Die Einwilligung des Patienten ist auch hier unabdingbar.
Klinische Studien werden vor ihrem Beginn behördlich geprüft und überwacht. Eine Ethikkommission kontrolliert ferner, ob die Bestimmungen zum Patientenschutz eingehalten werden.
Die Teilnahme an einer Studie bietet Patienten die Chance, eine neue Therapie zu erhalten, beispielsweise wenn keine etablierte Therapiemöglichkeit anschlägt. Allerdings sind die neuen Therapieansätze unter Umständen noch nicht so gut erforscht. Daher besteht das Risiko, dass die Studien-Therapie bei Ihnen doch nicht wirkt oder zu Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen führt.
Ob die Teilnahme an einer Studie für einen Patienten sinnvoll ist, muss in jedem Fall individuell entschieden werden. Eine ausführliche Beratung und sorgfältige medizinische Abwägung mit dem behandelnden Arzt sind deshalb unabdingbar.
Weiterführende Informationen für Patienten
Krebsberatungsstellen
Unterstützung bei sozialen und psychischen Themen
Krebsberatungsstellen sind Anlaufstellen, in denen Betroffene und ihre Angehörige bei der Bewältigung der sozialen und psychischen Folgen einer Krebserkrankung unterstützt werden. Zu den Kernaufgaben der Krebsberatungsstellen zählt die Information und Beratung zu sozialrechtlichen, wirtschaftlichen und seelischen Aspekten rund um die Erkrankung.
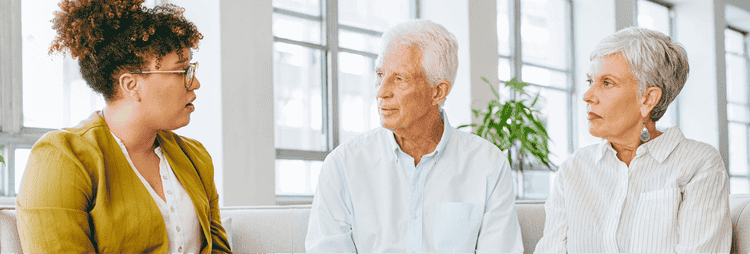
Im Krankenhaus erhalten Betroffene und Angehörige Unterstützung und Informationen meist direkt schon von den klinischen Sozialdiensten. Nach der Entlassung stehen ihnen die Krebsberatungsstellen zur Seite.
Die dort tätigen Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und Pädagogen, oft auch Psychologen und manchmal Mediziner beraten schwerpunktmäßig zu folgenden Themen:
- Lohnfortzahlung, Krankengeld, Haushaltshilfe
- Erwerbsminderungsrente, Berentungsmöglichkeiten und -konsequenzen
- Finanzielle Unterstützung durch Härtefallanträge
- Schwerbehindertenrecht und Schwerbehindertenausweis
- Anschlussheilbehandlung, Angebote zur Rehabilitation und Reha-Einrichtungen
- Informationen zu weiteren Sozialleistungen und Hilfen, u. a. auch Pflegeversicherung
- Vermittlung zu Behörden und Hilfe bei Antragstellungen
In den meisten Fällen bieten die Mitarbeiter der Krebsberatungsstellen auch psychosoziale Beratungen an, d. h. sie besprechen mit den Ratsuchenden die psychischen Auswirkungen der Erkrankung. Dazu gehören Ängste, Trauer, Rückzugstendenzen etc., die durchaus die ganze Familie betreffen können, und suchen gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungen.
Mitarbeiter der Krebsberatungsstellen kennen alle weiterführenden Unterstützungsangebote in der Region und können so zum Beispiel zu Psychoonkologen weitervermitteln. Sie wissen, wo Angehörige Unterstützung finden und ob es spezielle Angebote für die Kinder krebserkrankter Eltern gibt. Manchmal vermitteln sie auch bei Fragen im medizinischen Bereich zu Experten weiter.
Oft sind sie Kontaktstelle und Treffpunkt für die Selbsthilfegruppen, die es zu den verschiedenen Krebserkrankungen in dieser Region gibt. Zudem verfügen sie auch über Informationen bezüglich der bundesweiten Selbsthilfe-Initiativen, z. B. für seltene Erkrankungen.
Die kostenfreie Beratung erfolgt nach einer Terminvereinbarung in einem persönlichen Gespräch mit dem Ratsuchenden. Dann wird entschieden, in welcher Form die Beratung seitens der Beratungsstellen weitergehen soll. Auch Paar- und Familiengespräche oder der Austausch in einer größeren Gruppe können sinnvoll sein. Teil des Angebotes ist neben persönlichen Kontakten auch eine telefonische oder schriftliche Beratung.
Viele Krebsberatungsstellen bieten darüber hinaus verschiedene Informationsveranstaltungen und Kurse zur Unterstützung an. Das können Kurse in Entspannungstechniken, Nichtraucher-Kurse, gestalttherapeutische Kurse oder Bewegungsangebote sein. Fragen Sie bei der Krebsberatungsstelle in Ihrer Nähe nach.
Wie finde ich eine Krebsberatungsstelle in meiner Nähe?
- Adressen von Krebsberatungsstellen in Ihrem Bundesland finden Sie bei der Deutschen Krebsgesellschaft.
- Die Deutsche Krebshilfe hat ein Netz von psychosozialen Kompetenz-Krebsberatungsstellen aufgebaut, deren Adressen Sie dort finden.
- Der Krebsinformationsdienst bietet eine Suchfunktion nach Krebsberatungsstellen, die mindestens einen Mitarbeiter haben, der ein Studium der Psychologie, Sozialpädagogik oder Vergleichbares absolviert hat.
Finanzielle Regelungen in der Palliativpflege

Wer übernimmt die Kosten für die Palliativpflege?
Für Krebspatienten, die nur eine begrenzte Lebenserwartung haben, die unter Schmerzen leiden und auf die Unterstützung anderer angewiesen sind, kann viel getan werden, damit es ihnen in ihrer verbleibenden Zeit so gut wie eben möglich geht. Lesen Sie, in welcher Höhe und von wem die Kosten hierfür übernommen werden.
Unabhängig von den eigenen finanziellen Möglichkeiten hat jeder Krebspatient, dessen Krankheit nicht heilbar, fortschreitend und weit fortgeschritten ist, bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung Anspruch auf eine palliativmedizinische und/oder palliativpflegerische Versorgung. Hierbei wird zwischen stationärer und ambulanter Hospizleistung sowie spezialisierter ambulanter Palliativversorgung unterschieden.
Stationäre und ambulante Hospizleistungen
Stationär: Ist eine ambulante Versorgung im Haushalt oder in der Familie des Patienten nicht möglich, so hat der gesetzlich Versicherte gemäß § 39a Abs. 1 SGB V, soweit er keiner Krankenhausbehandlung bedarf, Anspruch auf Zuschuss zu stationärer oder teilstationärer Versorgung in einem Hospiz. Die Krankenkassen leisten einen Zuschuss zum stationären Hospizaufenthalt in Höhe von 95 % des mit dem jeweiligen Hospiz vereinbarten tagesbezogenen Bedarfssatzes. Der Zuschuss wird unter Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung auf Antrag gewährt.
Ambulant: Bedarf der Patient keiner Krankenhausbehandlung und keiner stationären oder teilstationären Versorgung in einem Hospiz, so kann er ambulante Hospizdienste zur qualifizierten Sterbebegleitung beantragen. Das Gesetz legt zwar keine konkreten Ansprüche für Patienten fest, die Krankenkassen haben aber ambulante Hospizdienste zu fördern, die diese Sterbebegleitung unter der fachlichen Verantwortung einer qualifizierten Person ehrenamtlich anbieten.
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)
Versicherte Patienten mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei zugleich begrenzter Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Versorgung benötigen, haben nach § 37b SGB V Anspruch auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV). Die SAPV dient dazu, dem Patienten eine medizinisch-pflegerische Behandlung einschließlich ihrer Koordination insbesondere im Bereich Schmerztherapie und Symptomkontrolle in vertrauter häuslicher oder familiärer Umgebung zu ermöglichen. Sie kann sowohl alleine als auch (in Teilleistungen) zusätzlich zu einer ambulanten oder stationären Hospizleistung als auch in stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder der Kinder- und Jugendhilfe erbracht werden.
Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung muss von einem Vertrags- oder Krankenhausarzt verordnet werden. Für die Vergütung und deren Abrechnung schließen die Krankenkassen in diesem Fall Verträge mit den zur Versorgungsdurchführung geeigneten Einrichtungen oder Personen. Genaueres regelt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seiner Richtlinie zur Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 14 SGB V.
Erkundigen Sie sich auch bei Ihrer Kranken- und/oder Pflegekasse (letzteres nur, wenn Sie in einem Pflegegrad eingeordnet sind). Dort bekommen Sie Informationen über mögliche Zusatzleistungen. Weitere Informationen finden Sie bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz.
Hier finden Sie Broschüren und Informationsmaterial für Betroffene und Angehörige
Dieser Text entspricht den redaktionellen Standards der JanssenWithMe und wurde von einem Mitglied des redaktionellen Beirats der JanssenWithMe geprüft. Lernen Sie hier den medizinischen Beirat unserer Redaktion kennen.
EM-150081
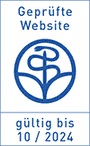
Das Gütesiegel bestätigt die gutachterliche Prüfung der Website im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens der Stiftung Gesundheit. Es stellt sicher, dass Gesundheitsinformationen in qualifizierter Weise zur Verfügung stehen und somit die Transparenz für Patient:innen fördert.
EM-142857

