MEIN KREBSRATGEBER
.jpg?width=750&height=538&format=jpg&quality=65)

Informationsportal für Patient:innen & Angehörige
Rund 18 Millionen Menschen leiden weltweit unter Krebs - allein Deutschland zählt fast 500.000 Neuerkrankungen jährlich.[1] Doch mit einer modernen, frühzeitigen Behandlung kann heute die Erkrankung zurückgedrängt und das Leben verbessert werden. MEIN KREBSRATGEBER bietet Ihnen als Betroffener oder Angehöriger wertvolles Wissen rund um das Thema Krebs, seine Facetten und die Lebensbereiche die er betrifft.
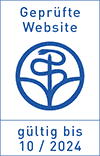
Krebsarten
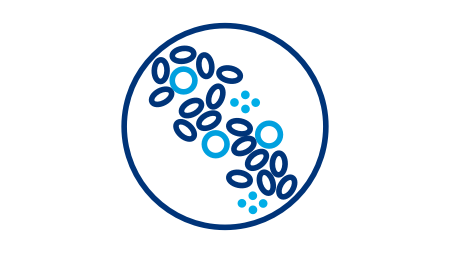
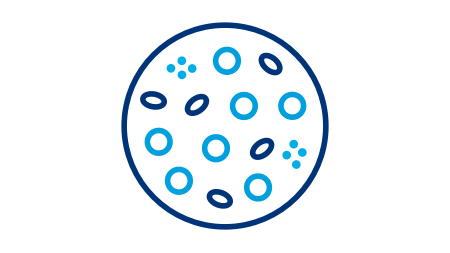


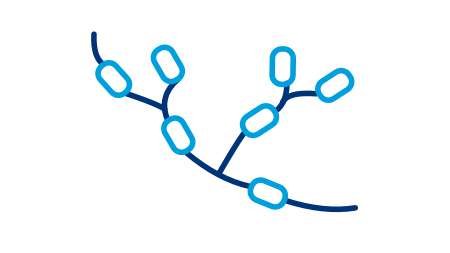
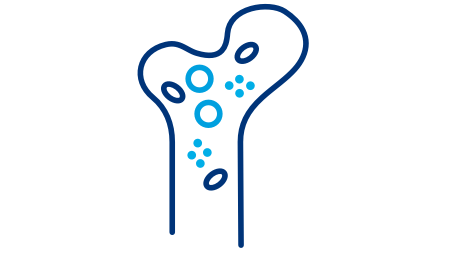
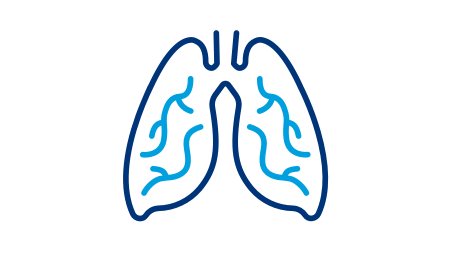
News
Über MEIN KREBSRATGEBER
Mit der Diagnose „Krebs“ gehen oft Ängste und Sorgen einher, Betroffene und Ihre Angehörigen haben viele Fragen. Mit MEIN KREBSRATGEBER hat Janssen ein umfangreiches Informationsportal entwickelt, um Sie in dieser schwierigen Lebensphase zu unterstützen. Auf dieser Webseite können Sie sich über verschiedene Krankheitsbilder informieren. Darüber hinaus finden Sie auf MEIN KREBSRATGEBER Antworten auf weitere Fragen, wie beispielsweise: „Wo finde ich eine Selbsthilfegruppe?“, „Was kann ich selbst tun, um meine Behandlung positiv zu unterstützen?“, „Welche Rechte habe ich als Arbeitnehmer, wenn ich krank werde?“, „Wer bezahlt meine Betreuung, wenn ich nicht mehr allein für mich sorgen kann?“.
Es ist uns eine Herzensangelegenheit stetig an einem besseren Leben für Menschen in Deutschland und weltweit zu arbeiten. Wir möchten Ihnen daher bei Ihrer Krebserkrankung beiseitestehen und Ihnen Mut machen. MEIN KREBSRATGEBER soll für Sie ein ganz persönlicher Begleiter sein und Sie in allen Phasen der Krebserkrankung und darüber hinaus unterstützen.

Psyche & Krebs
Die Diagnose Krebs ist meist sehr belastend und geht oft mit Ängsten und Sorgen einher. Beratungen durch einen Psychoonkologen können Ängste mildern und die Familie unterstützen. Hier finden Sie Informationen.
Ernährung & Krebs
Mit der richtigen Ernährung die Krebstherapie unterstützen – geht das? Diese Rubrik wurde in Zusammenarbeit mit Krebspatient:innen erstellt und beantwortet zahlreiche Fragen, die sich Betroffene und ihre Angehörigen zu diesem Thema stellen. Um Ihnen alltagstaugliche Hilfestellungen zu bieten, finden Sie hier auch Tipps und Rezepte, die unsere Partner selbst ausprobiert und für gut befunden haben.


Therapiemöglichkeiten
Was passiert bei einer Chemotherapie? Was ist eine Strahlentherapie? Hier finden Sie einen Überblick zu den möglichen Behandlungsoptionen in der Krebstherapie.
Glossar
In unserem Glossar befinden sich Fachbegriffe einfach und verständlich erklärt.

Dieser Text entspricht den redaktionellen Standards der JanssenWithMe und wurde von einem Mitglied des redaktionellen Beirats der JanssenWithMe geprüft. Lernen Sie hier den medizinischen Beirat unserer Redaktion kennen.
EM-150081
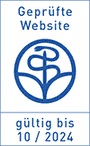
Das Gütesiegel bestätigt die gutachterliche Prüfung der Website im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens der Stiftung Gesundheit. Es stellt sicher, dass Gesundheitsinformationen in qualifizierter Weise zur Verfügung stehen und somit die Transparenz für Patient:innen fördert.
EM-142857
